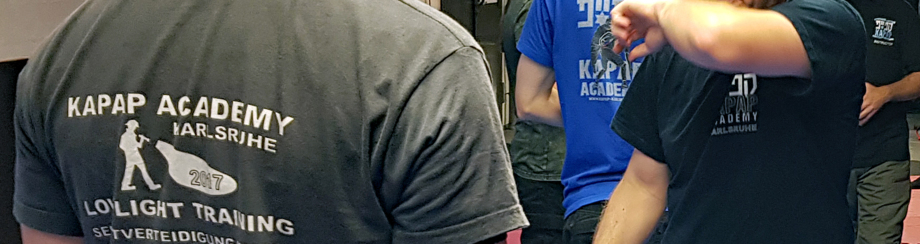Karlsruhe [ˈkaʁlsˌʁuːə] ist die drittgrößte Stadt des Landes Baden-Württemberg.
Karlsruhe ist ein Stadtkreis, Sitz des Regierungsbezirks Karlsruhe, der Region Mittlerer Oberrhein und des Landkreises Karlsruhe, der im Norden, Osten und Süden angrenzt. Im Westen wird die Stadt vom Rhein begrenzt, der hier die Grenze Baden-Württembergs mit Rheinland-Pfalz bildet. Karlsruhe liegt in der Trinationalen Metropolregion Oberrhein.
Das 1715 als barocke Planstadt mit sonnen- bzw. strahlenförmig vom Schloss ausgehenden Straßen gegründete Karlsruhe entwickelte sich zunächst nur in südliche Richtung. Aufgrund des so entstandenen fächerförmigen Grundrisses trägt Karlsruhe den Beinamen Fächerstadt. Karlsruhe war Haupt- und Residenzstadt des ehemaligen Landes Baden. Seit 1950 ist Karlsruhe Sitz des Bundesgerichtshofs und seit 1951 des Bundesverfassungsgerichts, weshalb die Stadt auch Residenz des Rechts genannt wird.
Karlsruhe liegt in der oberrheinischen Tiefebene an den kleinen Flüssen Alb und Pfinz sowie am Rhein und umfasst im Osten mit dem Turmberg und angrenzenden Höhen die letzten Ausläufer des Schwarzwaldes und des Kraichgaus.
Die Stadt liegt im Verdichtungsraum Karlsruhe/Pforzheim, zu dem die Stadt Karlsruhe, einige Gemeinden des Landkreises Karlsruhe (vor allem die Großen Kreisstädte Bruchsal, Ettlingen, Stutensee und Rheinstetten) sowie die Stadt Pforzheim, der nordwestliche Teil des Enzkreises, die Stadt Mühlacker und die Gemeinde Niefern-Öschelbronn im nordöstlichen Enzkreis gehören.
Innerhalb der Region Mittlerer Oberrhein bildet Karlsruhe ein Oberzentrum, von denen für ganz Baden-Württemberg nach dem Landesentwicklungsplan 2002 insgesamt 14 ausgewiesen sind. Darüber hinaus gibt es auch Verflechtungen mit Gemeinden in der Südpfalz und im Unterelsass in der Region Pamina (Palatinat, Mittlerer Oberrhein und Nord-Alsace).
Die Gesamtfläche der Stadt beträgt 173,46 Quadratkilometer. Somit steht sie flächenmäßig auf Platz 30 der deutschen Großstädte (siehe hierzu: Liste der Großstädte in Deutschland). Die größte Ausdehnung in Nord-Süd-Richtung beträgt 16,8 km, in Ost-West-Richtung 19,3 km. Der tiefste Punkt der Stadt liegt am Rhein beim Ölhafen auf 100 m ü. NN, der höchste Punkt im Tiergehege bei Grünwettersbach auf 322,7 m ü. NN.[2]
Der 49. Breitengrad verläuft durch Karlsruhe. Die Stadt liegt damit auf der gleichen geographischen Breite wie ein Großteil der Staatsgrenze zwischen den USA und Kanada und (annähernd) die Städte Regensburg, Prešov (Slowakei), Hulun Buir (China), Vancouver (Kanada) und Paris (Frankreich).
Karlsruhe ist mit einer Jahresmitteltemperatur von 10,7 °C eine der wärmsten Städte Deutschlands und mit einer jährlichen Sonnenscheindauer von im Mittel 1691,4 Stunden (Referenzperiode 1961–90)[3] auch eine der sonnigsten. Die geschützte Lage im Oberrheingraben hat zur Folge, dass in Karlsruhe im Sommer oft eine drückende Schwüle herrscht. Die Winter in Karlsruhe sind meist mild und oft durch den für das Rheintal typischen Hochnebel geprägt. Im langjährigen Mittel hat Karlsruhe 17,1 Eistage pro Jahr.[4]
In der näheren Umgebung der erst 1715 im Hardtwald gegründeten Planstadt Karlsruhe lagen mehrere Dörfer sowie die Städte Durlach und Mühlburg. Diese inzwischen nach Karlsruhe als Stadtteile eingemeindeten Orte haben eine längere Geschichte als die heutige Kernstadt.
In Knielingen, Rüppurr und Durlach sind Funde von Beilen und Bronzebarren aus der Bronzezeit belegt. 1911 fand man ein Gräberfeld mit zehn Bestattungen aus der jüngeren Eisenzeit.[8] Am Rand einer römischen Siedlung im Stadtteil Grünwinkel wurden 1922–1927 drei Ziegelöfen und ein Töpferofen freigelegt, die wohl vom Ende des 1. Jahrhunderts n. Chr. bis zum Ende des 2. Jahrhunderts betrieben wurden.[9] Ein Gräberfeld mit 44 Bestattungen und viele weitere Spuren wie einzelne Gräber, Ziegelbrennereien oder Münzen weisen auf eine römische Besiedlung hin.
786 wurde Knielingen erstmals urkundlich erwähnt.[10] Die Grafen von Hohenberg erbauten im 11. Jahrhundert die Burganlage auf dem Turmberg bei Durlach. 1094 stifteten sie das Benediktinerkloster Gottesaue, auf dessen Gelände seit dem späten 16. Jahrhundert das Schloss Gottesaue steht. Das Kloster begünstigte das Wachstum nahegelegener Siedlungen wie Mühlburg, Knielingen oder Neureut. In das Jahr 1196 fällt die erste urkundliche Erwähnung Durlachs als Stadt.[10]
1525 schlossen sich Mühlburg, Durlach und Neureut dem Bauernaufstand an. Baden-Durlach wurde 1556 protestantisch und in der Folge kauften sich die Neureuter 1563 von der Leibeigenschaft frei. Als 1565 Markgraf Karl II. seine Residenz von Pforzheim nach Durlach verlegte, erlebte die Stadt einen wirtschaftlichen und kulturellen Aufschwung.
Im Dreißigjährigen Krieg wurden Rintheim, Durlach, Hagsfeld und Mühlburg zerstört. Während des Pfälzischen Erbfolgekriegs zerstörten französische Truppen 1689 die Residenzstadt Durlach, Schloss Gottesaue, Rintheim, Mühlburg, Kielingen und Daxlanden, nicht zerstört wurde dagegen Rüppurr.
1699 siedelten sich geflohene Hugenotten in Neureut an. Es entwickelte sich ein neuer Ortsteil, der Welschneureut genannt wurde. Der alte Ortsteil hieß im Gegensatz dazu Teutschneureut.[11]
Der Legende nach soll Karl-Wilhelm, Markgraf von Baden-Durlach, einst bei einem Jagdausritt im Hardtwald bei Durlach eingeschlafen sein. Er träumte von einem prachtvollen Schloss, das sonnengleich im Zentrum seiner neuen Residenz liege, die Straßen der Stadt gleichsam die Sonnenstrahlen. Karl Wilhelm ließ sich seine Traumstadt am Reißbrett entwerfen (siehe auch: Planstadt) und gründete die nach ihm („Carols Ruhe“) benannte Stadt Karlsruhe am 17. Juni 1715 mit der Grundsteinlegung des Karlsruher Schlosses.
Die Sonnenstrahlen kann man noch heute gut auf den Straßenkarten erkennen: Das Schloss liegt im Zentrum eines Kreises, von dem aus strahlenförmig Straßen in die Stadt nach Süden und Alleen durch den Hardtwald nach Norden verlaufen. Vom Schlossturm im Zentrum hat man so Einblick in alle Strahlen. Es sind insgesamt 32 Straßen und Alleen. Diese Anzahl entspricht exakt der Einteilung der Kompassrose. Das südliche Viertel des Vollkreises bildete anfangs das bebaute Stadtgebiet. Dieser Grundriss erinnert auch an einen Fächer, weswegen Karlsruhe den Beinamen „Fächerstadt“ führt.
Karlsruhe ist eine der letzten großen europäischen Stadtgründungen auf dem Reißbrett und zugleich Ergebnis einer weitreichenden Idee: 1715 entschloss sich Markgraf Karl-Wilhelm, die mittelalterliche Enge seiner damaligen Residenz Durlach gegen den Bau einer neuen, in Anlage und Geist offenen Stadt einzutauschen. Seine Vorstellung einer Modellstadt der Zukunft fasst er in einem historischen Dokument von weitreichender Bedeutung zusammen, dem „Privilegienbrief“.
Der Brief trägt bereits viele Zeichen eines hochmodernen Staats- und Menschenbildes. In den „Privilegien“ scheint vieles auf, was sich die europäischen Völker in den Revolutionen der Folgezeit, bis ins 20. Jahrhundert hinein, als gutes Recht eines jeden Menschen erkämpfen werden: persönliche Freiheit, wirtschaftliche Freiheiten, Gleichheit vor dem Recht, politische Mitsprache.
An der Gründung Karlsruhes beteiligten sich Menschen aus Frankreich, Polen, Italien, der Schweiz und den vielen Ländern des damals noch zersplitterten Deutschlands. Der erste Bürgermeister der Stadt, Johann Sembach, stammte aus Straßburg.
Ab 1717 war Karlsruhe zunächst Residenz der Markgrafen und der Markgrafschaft Baden-Durlach und ab 1771 – nach der Wiedervereinigung mit der Markgrafschaft Baden-Baden – der gesamten Markgrafschaft Baden.
Von der Gründung bis ungefähr 1810 hatte die Residenzstadt Karlsruhe weniger als 10.000 Einwohner. Um 1850 waren in der damaligen Hauptstadt des Großhergzogtums Baden etwa 25.000 Einwohner erreicht. Mit der Industrialisierung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts setzte ein schnelleres Bevölkerungswachstum ein. Im Jahre 1901 wurde Karlsruhe mit dem Überschreiten der Grenze von 100.000 Einwohnern zur Großstadt. Bis 1939 erhöhte sich die Einwohnerzahl auf rund 190.000, wozu mehrere Eingemeindungen zwischen 1907 und 1938 beitrugen. Einen starken Einschnitt brachte der Zweite Weltkrieg. Durch Evakuierung, Flucht, Deportationen und Luftangriffe sank die Bevölkerungszahl bis auf rund 60.000 im April 1945. Bereits 1950 hatte sich die Zahl auf rund 200.000 erholt und gesteigert. Bis 1975 wuchs sie, auch durch weitere Eingemeindungen Anfang der 1970er Jahre, auf ein Zwischenhoch von 280.000. Bis in die späten 1980er-Jahre sank sie leicht und wurde im Zuge der Volkszählung von 1987 um weitere rund 8.000 Personen auf 260.000 korrigiert. Bis 2005 stieg die Einwohnerzahl erneut um 25.000 Personen. Am 30. September 2012 erreichte die „Amtliche Einwohnerzahl“ für Karlsruhe nach Fortschreibung des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg mit 300.711[17] (nur Hauptwohnsitze und nach Abgleich mit den anderen Landesämtern) einen historischen Höchststand. Der Ausländeranteil betrug zum 31. Dezember 2011 15,0%.[18]
Die Einwohnerentwicklung ist seit längerer Zeit durch Geburtendefizite der deutschen Bewohner geprägt. Obwohl Karlsruhe anhaltende Wanderungsverluste in die umliegenden Städte und Gemeinden zu verzeichnen hatte, wurden in den letzten Jahren auch Wanderungsgewinne durch ausländische und deutsche Bürger erzielt. Die wichtigsten Herkunftsländer sind die Türkei (6051), Italien (4181), Rumänien (2445), Kroatien (2268), Polen (2251), Serbien-Montenegro (1787), Russland (1659), Frankreich (1631), China (1290), Ukraine (1163), Spanien (1067) sowie Bosnien-Herzegowina (980) und Griechenland (890). 16.915 Nicht-Deutsche (39,5 %) sind Angehörige eines der 27 EU-Mitgliedstaaten. Rund 29.000 Deutsche haben einen Migrationshintergrund.[18]
19.382 und damit 45,2 % der 42.850 Ausländer in Karlsruhe leben seit mindestens acht Jahren in der Stadt; 3.298 sind in Karlsruhe geboren.[18]
Als Selbstverteidigung wird die Vermeidung und die Abwehr von Angriffen auf die seelische oder körperliche Unversehrtheit eines Menschen bezeichnet.[1] Die Spannweite solcher Angriffe beginnt bei Nichtbeachtung, unbedachten Äußerungen, Einnehmen von Gemeinschaftsraum, setzt sich fort über Beleidigungen, Mobbing und Körperverletzung und reicht bis zu schwersten Gewaltverbrechen. Dabei ist jedoch immer die Ausübung von Macht das Ziel des Täters.[2] Die weit überwiegende Anzahl solcher Angriffe wird nicht von Fremden, sondern von Bekannten (Mitschüler, Verwandte, Ehepartner) verübt.[3] Bei der Verteidigung gegen nicht-körperliche Angriffe spricht man heute auch von Selbstbehauptung (als Substantiv zu sich behaupten).[4]
Es existiert eine Reihe von Maßnahmen zur Vermeidung der beschriebenen Angriffe, die unter anderem in Einrichtungen der Familienbildung und Volkshochschulen erlernt werden können. Hier nur einige Beispiele: Wenn Kinder nicht zu Fremden ins Auto steigen und die Haustür nicht öffnen wenn es klingelt, dann vermeiden sie potentiell gefährliche Situationen. Ebenso handelt, wer um gewisse Menschengruppen lieber einen Bogen macht, Abkürzungen durch menschenleere Gegenden vermeidet, oder sich nicht verbal provozieren lässt.
Ein weiterer Ansatzpunkt ist die Tatsache, dass die meisten Täter erfolgreich sein wollen, das heißt also, nicht „erwischt“ werden wollen. Täter wollen ihr Opfer isolieren, also vom Schutz der Anderen abschneiden, eine wirksame Selbstverteidigung ist daher das Öffentlichmachen des Verbrechens. Darauf beruhen viele Methoden zur Vermeidung durch Abschreckung. Dazu gehört, in der Öffentlichkeit nicht hilflos oder überängstlich zu wirken, sondern durch das Auftreten zu vermitteln, sich im Zweifelsfall helfen zu können. Wenn Kinder nicht alleine sondern mit Freunden zur Schule gehen; wenn sie sich auch auf dem Pausenhof nicht alleine oder in schwer einsehbaren Ecken aufhalten, sondern in der Nähe der Aufsicht, schrecken sie mögliche Angreifer ab.
Die Abwehr eines Angriffes wird erforderlich, wenn Vermeidung und Abschreckung nicht funktioniert haben, sowie in Situationen, die nicht durch die Polizei oder Rechtsanwälte geregelt werden können.
Zu unterscheiden sind zwei Fälle:
- Der Angreifer ist ein Fremder, es handelt sich um einen einmaligen, akuten Angriff. Dann ist das wichtigste Ziel, Hilfe zu bekommen und die Situation entweder zu beenden oder ihr zu entkommen.
- Der Angreifer ist ein Bekannter oder Verwandter, der Angriff kann auch über einen längeren Zeitraum andauern. Hier ist Entkommen oft schwieriger, zum Beispiel für Kinder oder finanziell Abhängige.
Unter den juristischen Begriffen Notwehr und Nothilfe sind lediglich Maßnahmen zusammengefasst, die einen gegenwärtigen und rechtswidrigen Angriff von sich oder einem anderen abwenden, außerdem gilt als Notwehr auch der Schutz von Gegenständen und anderen Rechtsgütern. Angriffe, die nicht strafbewehrt sind oder deren Strafverfolgung durch Behörden aus praktischen Gründen nicht möglich ist, werden vom Notwehrbegriff nicht abgedeckt (Beispiel: Mobbing). Die Art und die Ausführung der Verteidigung muss so gewählt werden, dass der Angriff sicher und endgültig abgewendet werden kann. Bei mehreren Möglichkeiten soll die mildeste gewählt werden, der Verteidigende muss jedoch kein Risiko eingehen, wenn ein weniger schweres Mittel nicht mit Sicherheit zum Erfolg führt. Im Gegensatz zum populären Irrglauben sind die Auswirkungen der Notwehrhandlung auf den Angreifer irrelevant; weder ist ein Abwiegen von gesundheitlichen Schäden beim Angreifer erforderlich noch sind Verletzungen des Angreifers, die aus der Notwehrhandlung resultieren, strafbar. Die Flucht muss einem Verteidiger nicht zugemutet werden: „Das Recht braucht dem Unrecht nicht zu weichen.“
Die meisten Kampfsportarten waren einst Soldatenhandwerk, andere haben ihren Ursprung in kriminellen Strukturen (Savate). Heute sind sie Sportarten mit festen Regeln und dem Verbot, den Partner zu verletzen. In realistischen Abwehrsituationen herrscht jedoch von vornherein ein Machtgefälle: der Angreifer ist stärker/zahlreicher als der Verteidiger.[5] Die geistige Grundausrichtung der Kampfsportarten, einen gleich starken Partner zu besiegen, ist der Selbstverteidigungssituation prinzipiell entgegengesetzt, wo man einem überlegenen Angreifer entkommen will. Dennoch sind einzelne Kampfsport-Techniken auch im Ernstfall einsetzbar. Insbesondere Vollkontakterfahrungen der Kampfsportler können sich als hilfreich erweisen. Für Laien sind die Grenzen von Kampfsport/-kunst und Selbstverteidigung schwer zu sehen, da fast alle Kampfsportschulen mit Selbstverteidigung und geistiger Schulung werben. Entscheidend ist jedoch nicht, welches System man trainiert, sondern das Fachwissen des einzelnen Trainers, ob er also zum Beispiel weiß, wie man gefährliche Situationen erkennt und vermeidet.
Kampfkunst als Selbstverteidigung
Der Begriff Kampfsport ist zu unterscheiden von dem der Kampfkunst. Kampfkünste entstanden in Zeiten, in denen Menschen häufig mit Kämpfen konfrontiert waren und sich verteidigen mussten, sei es mit oder ohne Waffen. Um ihre komplexen und damit schwierig anzuwendenden Techniken und Prinzipien im Ernstfall zu beherrschen, ist häufig jahrelanges Studium der Kampfkünste vonnöten. Zu den bekanntesten gehören Wing Chun, Aikidō, Karate, Taekwondo und Jiu Jitsu. Unter den genannten ist Taekwondo inzwischen zur olympischen Disziplin, Karate zu einer vom IOC anerkannten Sportart geworden.
Soll eine Kampfkunst nach sportlichem Maßstab ausgeführt werden, müssen Reglementierungen getroffen und darin bestimmte Techniken von vornherein ausgeschlossen werden, um eine unmittelbare Schädigung des Gegners zu verhindern, z. B. der Tiefschlag beim Boxen oder Faustschläge ins Gesicht beim olympischen Taekwondo. "Wenn etwas [...] im Kampfsport als Verstoß gewertet wird, ist es wahrscheinlich hervorragend für die Selbstverteidigung geeignet.” (John Wiseman, Ausbilder der britischen Spezialeinheit SAS)[6] Als logische Konsequenz haben sich diese Kampfkünste, nach modernen Gesichtspunkten unterrichtet, zu Kampfsportarten entwickelt. Man kann daraus auch argumentieren, dass traditionelle, zur Selbstverteidigung optimierte Disziplinen, kaum eine disziplinarische Begrenzung ihres technischen Repertoires anstreben.
Selbstverteidigungssysteme
Spezielle Selbstverteidigungssysteme wurden mit der alleinigen Ausrichtung auf Selbstverteidigung geschaffen. Ihnen fehlt der künstlerische und spirituelle Anspruch einer Kampfkunst. Diese Systeme haben oft einen militärischen Hintergrund (Nahkampf) und sind darauf ausgerichtet, den Schülern möglichst schnell grundlegende Selbstverteidigungsfähigkeiten zu vermitteln.
Von der Selbstverteidigung ist die Selbstbehauptung nur unscharf abzugrenzen: Mit diesem Begriff wird meist die Durchsetzung der eigenen Rechte mit verbalen, unverletzenden Mitteln bezeichnet.[7] Besonders Menschen mit geringem Selbstwertgefühl und geringem sozialem Wissen haben es schwer, ihre Bedürfnisse, Ansichten und Interessen gegen andere, auch in einer Gruppe, durchzusetzen. Daher werden sie häufiger Opfer der psychisch-manipulativen „Machtspiele“ des Alltags, die im schlimmsten Fall bis zum Mobbing gehen können. Mit der Selbstverteidigung gegen diese Übergriffe, die sehr viel häufiger als akute körperliche Gewalttaten sind, beschäftigt sich die Selbstbehauptung. „Das Selbstbehauptungstraining ist eine Ansammlung von Methoden, die soziale Ängste und Kontaktstörungen wie Selbstunsicherheiten abbauen soll. Durchsetzungsvermögen und soziale Kompetenz sollen erlernt werden.“[8]
Problematisch ist, dass sich Mobbing meist schwer nachweisen lässt, da es meistens durch eine Vielzahl unterschiedlichster Aktivitäten über einen langen Zeitraum mehr psychologisch als physisch erfolgt. Das „Selbstbehaupten durch Hauen“ allerdings ist schnell zu beweisen, vor allem, wenn der Angreifer gegen eine Gruppe agiert, deren Mitglieder hinterher als Zeugen auftreten können.
Das Selbstverteidigungsrecht ist auch im Völkerrecht verankert. In Artikel 51 UN-Charta ist die Rede von einem „naturgegebenen Recht zur individuellen oder kollektiven Selbstverteidigung“. Unter individueller Selbstverteidigung wird hier das Recht eines einzelnen Staates verstanden, sich gegen kriegerische Auseinandersetzungen zu wehren. Bei kollektiver Verteidigung ist die Hilfeleistung eines unbedrohten Staats für einen anderen Staat angesprochen, der sich einem bewaffneten Angriff ausgesetzt sieht.[9] Die Berufung auf dieses Selbstverteidigungsrecht muss eine Handlung gegen eine konkrete, unmittelbar drohende Gefahr sein (Präemption). Ob eine Bedrohung, ein Bruch des Friedens oder eine Angriffshandlung vorliegt, wird nach Art. 39 UN-Charta durch den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen festgestellt. In den Grenzen des Artikel 51 UN-Charta haben sich Verteidungsbündnisse gebildet; eines hiervon ist die NATO. Prävention ist hingegen auf eine lediglich mittelbare Bedrohung gerichtet und völkerrechtlich unzulässig. Die Präventivdoktrin der USA - etwa wegen des „Kriegs gegen den Terror“ oder gegen vermeintliche atomwaffenherstellende Staaten - wird in den USA als zulässige Präemption verstanden, ist jedoch völkerrechtswidrig, weil bisher weder Pläne noch Vorbereitungshandlungen als unmittelbar drohende Gefahr nachgewiesen werden konnten. Allerdings hatte der Sicherheitsrat in seinen Resolutionen 1368 (2001) und 1373 (2001) unter Berufung auf die Terrorakte das Recht auf Selbstverteidigung im Sinne der UN-Charta bekräftigt.
Krav Maga
Krav Maga (hebr. קרב מגע „Kontaktkampf“) ist ein israelisches, modernes, eklektisches Selbstverteidigungssystem, das Schlag- und Tritttechniken präferiert, aber auch Grifftechniken, Hebel und Bodenkampf beinhaltet.
Etymologie
Der Name Krav Maga (קרב מגע) bedeutet „Kontaktkampf“, wobei krav (קרב) „Kampf“ und maga (מגע) „Kontakt“ bedeutet.
Geschichte

Slowakei: Selbstverteidigung gegen antisemitische Schläger
Die Ursprünge des Krav Maga gehen auf den 1910 in Budapest geborenen Imrich Lichtenfeld zurück, der in Bratislava aufwuchs. Lichtenfeld war als Boxer und Ringer erfolgreich und hatte von seinem Vater, einem Polizisten, Jiu-Jitsu-Techniken gelernt. In den 1930er Jahren lehrte Lichtenfeld zum ersten Mal seine Kampfmethode, um die dort lebenden Juden gegen antisemitische Übergriffe zu unterstützen. Lichtenfeld emigrierte 1940 aus der Slowakei. Nach einer abenteuerlichen Flucht und einer Zeit bei der britischen Armee durfte er 1942 nach Palästina einreisen.
Palästina bzw. Israel: militärischer Nahkampf
Im damaligen britischen Protektorat Palästina unterrichtete er, zuerst mit britischer Unterstützung, Nahkampf in den zionistischen Untergrundorganisationen Haganah und Palmach. Seinen Familiennamen änderte er in die hebräische Form Sde-Or. Nach Gründung des Staates Israel 1948 wurde Lichtenfeld Nahkampfausbilder in der israelischen Armee.
Israel, später weltweit: Selbstverteidigungssystem
Nach seiner Tätigkeit in der Armee adaptierte Imrich Lichtenfeld das militärische Krav Maga für Polizisten und Zivilisten. Dazu wurden die Techniken der nichtmilitärischen Rechtslage angepasst (Notwehr). Nach dem Tode Lichtenfelds im Januar 1998 erhoben mehrere seiner Schüler den Anspruch auf den Titel des „legitimen Nachfolgers“ im Bereich des zivilen Krav Maga, so z. B. Gabi Noah (Leiter IKM International Krav Maga), Haim Gidon (Leiter Israeli Krav Maga Association), Eyal Yanilov (Leiter Krav Maga Global), Avi Moyal (Leiter International Krav Maga Federation), Haim Zut (Leiter Krav Maga Federation Haim Zut) oder Yaron Lichtenstein.
| weiß | ||
| gelb | ||
| orange | ||
| grün | ||
| blau | ||
| braun | ||
| schwarz | ||
Krav Maga in der Gegenwart
Heute wird Krav Maga weltweit unterrichtet. Dabei muss zwischen drei Zielgruppen unterschieden werden:
- Krav Maga für Privatpersonen – zur Selbstverteidigung, zur Deeskalation, zur Stressresistenz und als Zusatznutzen für die Gesundheit/Fitness[1]
- Krav Maga für den Sicherheitsbereich bzw. die Polizei
- Krav Maga für das Militär
Die Zielsetzung für Privatpersonen besteht darin, Menschen effektive und einfache Methoden an die Hand zu geben, um sich gegen Gewalt behaupten zu können. Für viele gibt der Spaß- und Fitnessfaktor den Ausschlag, Krav Maga zu trainieren. In den USA wird Krav Maga beispielsweise stark als „Fitnesssystem“ genutzt.
Im Sicherheitsbereich und bei der Polizei sind die Schwerpunkte der Ausbildung Deeskalation, Eigenschutz, Einsatztaktik, Personenschutz, Veranstaltungsschutz sowie Abführ- und Kontrolltechniken. Die Zielsetzung für den militärischen Einsatz ist die Ausbildung von militärischem Personal in Nahkampfmethoden.
Krav Maga im zivilen Bereich
Krav Maga zeichnet sich durch einfache Techniken aus. Natürliche und instinktive Reaktionen werden im System berücksichtigt und sinnvoll eingebunden. Dadurch ist Krav Maga relativ schnell zu erlernen. Krav Maga ist seinem Selbstverständnis nach kein Sport, sondern ein reines Selbstverteidigungssystem. Es gibt keine Wettkämpfe. Besonders das richtige Reagieren unter Stress wird trainiert. Dabei wird der richtigen Taktik in Gefahrensituationen viel Raum eingeräumt. Es geht auch darum, Gefahren frühzeitig zu erkennen und durch geschicktes Verhalten dem Konflikt auszuweichen.
Aufgrund der historischen Entwicklung, des Kampfsport-Hintergrundes vieler Vertreter und der Orientierung nach Prinzipien und weniger nach starren Techniken sind inzwischen verschiedene Organisationen und Interpretationen des Krav Maga entstanden, die sich teilweise in der Auswahl der Techniken (vor allem bei fortgeschritteneren Programmen) und Trainingsmethoden unterscheiden. Im deutschsprachigen Raum werden mittlerweile unterschiedlichste Krav-Maga-Varianten unterrichtet.
Verschiedene Krav-Maga-Verbände aus dem Ausland bieten Seminare in Deutschland an. Ein Beispiel hierfür ist das Krav Maga von Moni Aizik (Commando Krav Maga). Im internationalen Vergleich war die International Krav Maga Federation (IKMF) die größte Krav-Maga-Organisation. Der ehemals zur IKMF gehörende amerikanische Krav-Maga-Verband nennt sich seit 2005 Krav Maga Worldwide und versucht, über die USA hinaus zu expandieren. Im Juni 2010 trennte sich Eyal Yanilov von der IKMF und gründete mit Krav Maga Global (KMG) einen neuen weltweiten Krav-Maga-Verband. Die Leitung der IKMF übernahm Avi Moyal. Dadurch ist die IKMF in ihrer Größe deutlich reduziert worden, weist aber immer noch eine internationale Verbreitung auf.
Krav Maga bei der Bundeswehr
An der Luftlande- und Lufttransportschule der Bundeswehr lehren seit Anfang 2008 zwei IKMF-Instruktoren militärisches Krav Maga im Rahmen des Einzelkämpferlehrgangs.[2] Außerdem wird seit zwei Jahren an der Bundeswehr-Universität in Hamburg Krav Maga Survival unterrichtet.[3]
Krav-Maga-Techniken und -Methoden
Im Krav Maga werden je nach Zielgruppe unterschiedliche Techniken und Methoden trainiert.
Dazu zählen:
- verbale Deeskalation
- Rollenspiele
- Bewegungslehre
- 360-Grad-Abwehr
- Innenabwehr
- Fausttechniken
- Handballentechniken
- Hammerschläge
- Ellbogentechniken
- Tritttechniken
- Knietechniken
- Einsatz von Alltagsgegenständen zur Selbstverteidigung
- Waffenabwehr, gezielte Entwaffnung von Gegnern
- Stressdrills
- Situationstraining
- Mugging Training (Training mit einem Vollkontaktschutzanzug).
Verhältnis zu KAPAP
Innerhalb des israelischen Militärs existieren verschiedene Nahkampfsysteme. Der allgemeine und offizielle Begriff für alle diese Systeme ist KAPAP (hebr. קפא"פ) (Abkürzung für Krav Panim el Panim, hebr. קרב פנים אל פנים, dt. Kampf von Angesicht zu Angesicht). Durch den internationalen Erfolg von Krav Maga inspiriert begannen auch andere Nahkampfausbilder ihre Systeme an die Erfordernisse von Zivilpersonen anzupassen, teilweise auch unter dem Namen Krav Maga, etwa Moni Aizik (Commando Krav Maga) oder Amnon Maor (Krav Maga Maor).
Literatur
- Imi Sde-Or, Eyal Yanilov: Krav Maga. Abwehr bewaffneter Angriffe. 1. Auflage. Weinmann-Verlag, Berlin 2003, ISBN 3-87892-074-1.
Weblinks
- Israeli Krav Maga Association - Der älteste Krav Maga Verband der direkt auf Imrich Lichtenfeld zurückgeht.
- International Krav Maga Federation Deutschland – (IKMF)
- Krav Maga Self Protect Association – Grösster Krav-Maga-Verband der Schweiz
- Krav Maga Global Deutschland – Verband von Eyal Yanilov, der sich im Juni 2010 von der IKMF trennte
- German Krav Maga Federation – Verband gegründet von einem ehemaligen IKMF Trainer aus Deutschland
- Krav Maga Schulen in Deutschland – verbandsfreie Webseite mit ca. 90 % aller Krav-Maga-Schulen in Deutschland
Einzelnachweise
- Hochspringen ↑ Raphael Geiger: Der Verteidigungsminister. Wie ein Engländer seinen Kunden beibringt, sich gegen Randalierer auf der Straße zu wehren. Der Spiegel, 7. November 2011, abgerufen am 5. März 2013.
- Hochspringen ↑ Das tut richtig weh. In: Y – Das Magazin der Bundeswehr. 26. Mai 2009, abgerufen am 5. März 2013 (PDF; 952 kB).
- Hochspringen ↑ KRAV MAGA SURVIVAL an der HSU Universität der Bundeswehr Hamburg Kampfsport. YouTube, 6. Februar 2012, abgerufen am 5. März 2013.
Krav Maga
 "Krav maga" lesson in paratrooper school in Israel, 1955
|
|
| Focus | Hybrid |
|---|---|
| Country of origin | |
| Creator | Imi Lichtenfeld |
| Parenthood | Muay Thai, Boxing, Kung Fu, Wrestling |
| Olympic sport | No |
Krav Maga /krɑːv məˈɡɑː/ (Hebrew: קרב מגע [ˈkʁav maˈɡa], lit. "contact combat") is a self-defense system developed for military in Israel and Hungary that consists of a wide combination of techniques sourced from boxing, Muay Thai, Wing Chun, Judo, jiu-jitsu, wrestling, and grappling, along with realistic fight training. Krav Maga is known for its focus on real-world situations and extremely efficient and brutal counter-attacks.[1] It was derived from street-fighting skills developed by Slovakian-Israeli martial artist Imi Lichtenfeld, who made use of his training as a boxer and wrestler, as a means of defending the Jewish quarter against fascist groups in Bratislava[2] in the mid-to-late 1930s. In the late 1940s, following his immigration to Palestine, he began to provide lessons on combat training to what was to become the IDF, who went on to develop the system that became known as Krav Maga. It has since been refined for civilian, police and military applications.[3]
Krav Maga has a philosophy emphasizing threat neutralization, simultaneous defensive and offensive maneuvers, and aggression.[4] Krav Maga is used by Israeli Defense Forces, both regular and special forces, and several closely related variations have been developed and adopted by law enforcement and intelligence organizations, Mossad and Shin Bet. There are several organizations teaching variations of Krav Maga internationally.[5] [6] [7]
Contents
Etymology
The name in Hebrew can be translated as "contact combat". The root word krav (קרב) means "battle" or "combat" and maga (מגע) means "contact".
Basic principles
Krav Maga encourages students to avoid confrontation. If this is impossible or unsafe, it promotes finishing a fight as quickly as possible. Attacks are aimed at the most vulnerable parts of the body, and training is not limited to techniques that avoid severe injury. Drills provide maximum safety to students by the use of protective equipment and the use of reasonable force.
Students learn to defend against all variety of attacks and are taught to counter in the quickest and most efficient way.
Ideas in Krav Maga include:[1]
- Counter attacking as soon as possible (or attacking pre-emptively).
- Targeting attacks to the body's most vulnerable points, such as: the eyes, neck/throat, face, solar plexus, groin, ribs, knee, foot, fingers, etc.
- Maximum effectiveness and efficiency in order to neutralize the opponent as quickly as possible.
- Maintaining awareness of surroundings while dealing with the threat in order to look for escape routes, further attackers, objects that could be used to defend or help attack, and so on.
Training can also cover situational awareness to develop an understanding of one's surroundings, learning to understand the psychology of a street confrontation, and identifying potential threats before an attack occurs. It may also cover ways to deal with physical and verbal methods to avoid violence whenever possible.
History
Imrich Lichtenfeld (also known as Imi Sde-Or) was born in 1910 in Budapest, Hungary and grew up in Bratislava (Slovakia). Lichtenfeld became active in a wide range of sports, including gymnastics, wrestling, and boxing. In 1928, Lichtenfeld won the Slovakian Youth Wrestling Championship, and in 1929 the adult championship (light and middle weight divisions). That same year, he also won the national boxing championship and an international gymnastics championship. During the ensuing decade, Imi's athletic activities focused mainly on wrestling, both as a contestant and a trainer.
In the mid-1930s, anti-Semitic riots began to threaten the Jews of Bratislava. Lichtenfeld became the leader of a group of Jewish boxers and wrestlers who took to the streets to defend Jewish neighborhoods against the growing numbers of national socialist party and anti-Semitic thugs. Lichtenfeld quickly discovered, however, that actual fighting was very different from competition fighting, and although boxing and wrestling were good sports, they were not always practical for the aggressive and brutal nature of street combat. It was then that he started to re-evaluate his ideas about fighting and started developing the skills and techniques that would eventually become Krav Maga. Having become a thorn in the side of the equally anti-Semitic local authorities, Lichtenfeld left his home, family and friends in 1940 on the last refugee ship to escape Europe.
After making his way to the Middle East, Lichtenfeld joined Israel’s pre-state Haganah paramilitary organization to protect Jewish refugees from local inhabitants. In 1944 Lichtenfeld began training fighters in his areas of expertise: physical fitness, swimming, wrestling, use of the knife, and defenses against knife attacks. During this period, Lichtenfeld trained several elite units of the Haganah and Palmach (striking force of the Haganah and forerunner of the special units of the Israel Defense Forces), including the Pal-Yam, as well as groups of police officers.
In 1948, when the State of Israel was founded and the IDF was formed, Lichtenfeld became Chief Instructor for Physical Fitness and Krav Maga at the IDF School of Combat Fitness. He served in the IDF for about 20 years, during which time he developed and refined his unique method for self-defense and hand-to-hand combat. Self-defense was not a new concept, since nearly all martial arts had developed some form of defensive techniques in their quest for tournament and/or sport dominance. However, self-defense was based strictly upon the scientific and dynamic principles of the human body. Before retiring from the military, Lichtenfeld elected Eli Avikzar his military successor. With Lichtenfeld's blessing, Avikzar went on to strengthen Krav Maga with the addition of new techniques which maintained Krav Maga's central principles of maximum effectiveness and efficiency. Boaz Aviram succeeded Avikzar as Chief Instructor, and was followed only by a handful of others.[8] [9]
Upon Imrich Lichtenfeld's retirement he decided to open a Dojo Martial Art school and teach a civilian form of the military form of Krav Maga intending to keep most of the secrets of the system in the military, but yet teach a civilian version suitable for youth.[10] Some of the first students to receive a black belt in Lichtenfeld's civilian Krav Maga Association of 1st Dan, were: Eli Avikzar, Raphy Elgrissy, Haim Zut, Shmuel Kurzviel, Haim Hakani, Shlomo Avisira, Vicktor Bracha, Yaron Lichtenstein, Avner Hazan and Miki Asulin.[11]
In 1978, Lichtenfeld founded the non-profit Israeli Krav Maga Association (IKMA) with several senior instructors.[12] Lichtenfeld died in January 1998 in Netanya, Israel.[13]
When Krav Maga started to spread beyond the borders of Israel, there arose a need to found an international civilian organization. A few of Lichtenfeld's first and second generation students eventually formed a new, civilian, international Krav Maga federation.
Grading system
| White | ||
| Yellow | ||
| Orange | ||
| Green | ||
| Blue | ||
| Brown | ||
| Black | ||
Most of the Krav Maga organizations in Israel, such as the IKMA (Israeli Krav Maga Association, by Haim Gidon), KMF (Krav Maga Federation, by Haim Zut) and Bukan (By Yaron Lichtenstein), use Imi Lichtenfeld's colored belt grading system which is based upon the Judo ranking system. It starts with White belt, and then Yellow, Orange, Green, Blue, Brown and Black belts. Black belt students can move up the ranks from 1st to 9th Dan. The time and requirements for advancing have some differences between the organizations. In Europe the Fédération Européenne de Krav Maga (by Master Richard Douieb) and Krav Maga Academy Slovenia (by Master Karli Zaniug) also uses the colored belt grading system which is based upon the Judo ranking system.
Other organizations who teach Krav Maga in and outside of Israel like the International Krav Maga Federation (IKMF), Krav Maga Global (KMG) and International Krav Maga (IKM) use the same grading system based on a series of patches.[14] The patch system was developed by Imi Lichtenfeld after the belt system in the late 1980s. The grades are divided into 3 main categories; Practitioner, Graduate and Expert. Each of the categories, which are often abbreviated to their initials, has 5 ranks. Grades P1 through to P5 are the student levels and make up the majority of the Krav Maga community. After P5 are G1-G5, and in order to achieve Graduate level the student has to demonstrate a proficiency in all of the P level techniques before advancing. The majority of instructors hold a G level grade and are civilian instructors. However, passing the instructor's training course is a requirement, and holding a Graduate rank does not necessarily make one an instructor. The Graduate syllabus also builds on the Practitioner syllabus by focusing more on developing fighting skills. The Expert grades cover more advanced military and 3rd party protection techniques as well as advanced sparring and fighting skills. People who hold these ranks tend to teach in other sectors such as military and law enforcement in addition to civilian. In order to progress to Expert level, one has to demonstrate proficiency in all of the Practitioner and Graduate syllabi and have excellent fighting skills. Beyond Expert 5 there is the rank of Master. However, this rank is held by only a small number of individuals and reserved only for those who have dedicated a lifetime to Krav Maga and made valuable contributions in teaching and promoting the style.
Krav Maga organizations in the United States, South America and Europe such as Krav Maga Worldwide, Krav Maga Alliance, South American Federation of Krav Maga, Fédération Européenne de Krav-Maga (European Federation of Krav Maga), Hagana System and Krav Maga Academy Slovenia (KMAS) also use a belt ranking system like that of the IKMA, KMF and Bukan. Although there are some subtle differences, the various organisations teach the same core techniques and principles.
Competition
The Israeli Defense Force held its first ever Krav Maga tournament in May of 2013..[15]
Further reading
- Imi Sde-Or (founder) and Eyal Yanilov (head instructor) How To Defend Yourself Against Armed Assault, Dekel Publishing house, 2001. This book is the first one published out of the only three books that were written by the founder (Imi) and his closest assistant (Eyal). It has been translated into 10 languages, including: Japanese, Spanish, Czech, Hungarian, German, Dutch, French, Polish and more…
- Aviram, Boaz. Krav Maga - Use of The Human Body as a Weapon; Philosophy and Application of Hand to Hand Fighting Training System. US: Lulu Enterprises, 2009. ISBN 978-0-557-24846-9, ISBN 0-557-24846-9.
- Ben Asher, David. Fighting Fit. The Israeli Defense Forces Guide to Physical Fitness and Self Defense. New York: Perigee Books, 1983. ISBN 0-399-50624-1.
- Kahn, David. Krav Maga: an essential guide to the renowned method for fitness and self-defence. London: Piatkus, 2005. ISBN 0-01-303950-4.
- Levine, Darren. Complete krav maga: the ultimate guide to over 200 self-defense and combative techniques. Berkeley, Calif.: Ulysses, 2007. ISBN 1-56975-573-6.
- Philippe, Christophe. The essential Krav Maga: self-defense techniques for everyone. Berkeley, Calif.: Blue Snake, 2006. ISBN 1-58394-168-1.
- Master Ofir. HAGANA SYSTEM: Self Protection Academy Founded by Ofir. Paris: Editions Amphora 2012.
- Stevo, Allan [16]
References
- ^ Jump up to: a b Poulomi Banerjee (2009-01-28). "Contact combat: Self-Defence classes to stay safe". The Telegraph. Retrieved 2013-03-05.
- Jump up ^ Hodsdon, Amelia (2005-02-08). "Get your kicks with Israeli tricks". The Guardian. Retrieved 2013-03-05.
- Jump up ^ "The mother of all fightbacks". Daily Telegraph. 2005-10-22. Retrieved 2013-03-05.
- Jump up ^ "All change on the buses". BBC News. 1998-01-15. Retrieved 2013-03-05.
- Jump up ^ Jim Wagner and Maj. Avi Nardia. "Inside Israel". Black Belt Magazine. Archived from the original on 2010-05-11. Retrieved 2009-12-31.
- Jump up ^ Judy Ellis (1998-05-04). "Choke! Gouge! Smash!". Time. Retrieved 2010-01-01.
- Jump up ^ Ryan, Rosalind (2002-08-23). "J.Lo's fitness fad and Salma's 'sweaty' hobby". Daily Mail. Retrieved 2013-03-05.
- Jump up ^ "About Krav Maga". IKMF UK. Retrieved 2013-03-05.
- Jump up ^ "Founder of Krav Maga". krav-maga.com. Retrieved 2013-03-05.
- Jump up ^ Gonzalez Jr., Arturo (1976-11-15). "It's Called 'Kosher Kungfu' but Imi Lichtenfeld's New Martial Art Is a Deadly Affair". People Magazine. Retrieved 2011-10-10.
- Jump up ^ "Emrich Lichtenfeld (sde-or)". K.A.M.I. - Krav Magen History. Retrieved 16 July 2013.
- Jump up ^ "About The Israeli Krav Maga Association". KravMagaIsraeli. Retrieved 2012-05-17.
- Jump up ^ Bob Riha, Jr. (2005-02-24). "Krav Maga teaches practical self-defense in tough workout". USA Today. Retrieved 2013-03-05.
- Jump up ^ "Grading System". krav-maga.com. Retrieved 2013-03-05.
- Jump up ^ "Elite soldiers fight it out in IDF’s first-ever Krav Maga tournament". Israeli Defense Forces. 2013-05-27.
- Jump up ^ Allan Stevo (2011-06-23). "The Martial Arts / Self-Defense Style Invented in Bratislava". Retrieved 2013-03-05.
KAPAP
|
|
|
 British colonial soldiers practicing stick fighting in India
|
|
| Focus | Hybrid |
|---|---|
| Country of origin | |
| Parenthood | Bare knuckle boxing, Greco Roman wrestling, knife fighting, judo, jujutsu, British and Indian stick fighting. |
| Olympic sport | No |
KAPAP (Hebrew: קפא"פ, קפ"פ) is an acronym for Krav Panim el Panim, translated as "face to face combat", is a close quarter battle system of defensive tactics, hand-to-hand combat and self defense.
Contents
History
The KAPAP system was developed in the late 1930s, within the Jewish Aliyah camps (ma-ḥa-not Olim) as part of preparatory training before their arrival in the British Mandate of Palestine.[citation needed] The Palmach and Haganah used KAPAP as an ongoing combat development program for their recruits.
It was primarily considered a practical skill set that was acquired during the training period of the Palmach and Haganah fighters. The main focus was to upgrade the physical endurance, elevate and strengthen the spirit, developing a defensive and offensive skill set. It included physical training and endurance, cold weapon practical usage, boxing, judo, jujutsu, karate and knife and stick fighting.
In the early 1950s the term KAPAP was used interchangeably with the term Krav Maga as elements of the syllabus altered. By the time the 1960s came, the term was used only within certain units who needed more than basic training in Krav Maga such as Unit 216, Sayeret Matkal (Ariel Sharon also served in this unit). Special units required skill sets that suited their function. Units such as non-military police special units like Yamam require more than striking and neutralization in their skillsets. It should also be noted that not all Special Forces fall under the IDF (Israeli Defense Forces). Modern KAPAP has evolved in units such as these and also at Lotar (Israel's school of Anti-Terrorism).
Main contributors
- Gershon Kopler: judo and jujutsu Instructor who organized and established the self-defense concept as part of the KAPAP training in the Palmach and Haganah.
- Yehuda Marcus: Palmach's physical training judo and jujitsu chief Instructor, who replaced Gershon Kopler;
- Moshe Finkel: Palmach's fitness training officer, integrated the different typologies of the art into the training regime.
- Yitzhak Sade: Palmach's commander who adopted the KAPAP training into the regiment.
- Maishel Horovitz: Palmach's official KAPAP Instructor, was in charge of the development of the short stick fight tactics at the Palmach and made it famous to the term KAPAP. Maishel Horowitz died in December 2009.[1]
In the 1930s, as a leader of the youth movement "Mhanot Haolim", Horovitz faced a problem of dealing with British policemen armed with clubs. It was for this purpose that together with fellow members of the youth movement he developed the short stick fighting method. Horovitz's method became one of the main components of hand to hand combat training for all Haganah. Horovitz had made a major contribution to the development of KAPAP. According to the historian Noah Gross, Horovitz did not even know that such a thing as Krav Maga existed or that his stick fighting system was taught to soldiers as late as 1959. The short stick method became most popular by use, due to the adaptation of the young generation of recruits. Among the sticks used in the KAPAP fighting, the short stick was most commonly used and therefore practiced. It was favored due to its concealability in the sleeve until the actual fight began (Mêlée) on the streets.
Lieutenant Colonel (Res) Chaim Pe'er is the President and founder of the International KAPAP Federation. He is recognized internationally as a Soke – founder of the modern KAPAP system.
Training
The KAPAP method was and still is based on principles and not techniques.
Modern day system
KAPAP is a term used today to differentiate itself from the many Krav Maga schools around the world. Lt. Col. (Res) Chaim Pe'er[2] of Unit 216, Sayeret Matkal heads the International KAPAP Federation. Major Avi Nardia (Unit 216 Sayeret Matkal and Yamam Hand to Hand Combat instructor) developed many of the techniques now seen in modern Krav Maga, very specifically many of the gun disarms which were not in historical KAPAP and therefore Krav Maga.
Modern KAPAP highly evolved from its historical counterpart and advances many of its concepts so that modern day operational men and women can remain safe in the line of duty and so that civilians can defend against modern threats.
Historical KAPAP is not Krav Maga, yet its roots can clearly be seen in historical KAPAP. Modern KAPAP has evolved further, as have other Israeli systems under men like Dennis Hanover.[3] Krav Maga has by commercialisation become the most well known Israeli martial art, but it has never been the only martial art. Where training requires a unit do a different and specialised job, training must be bent to suit its needs.
Youth movements in Israel, like HaNoar HaOved VeHaLomed also practice KAPAP to remember the connection between the youth movement and the defense forces.
KAPAP Europe
KAPAP Europe is organized and headed by KAPAP Level 4 instructors, Sam Markey and William Paardekooper. Sam and William are the highest-ranking member of the International KAPAP Federation in Europe. Markey holds monthly seminars in the United Kingdom to train and develop the European KAPAP Instructor Team and William holds courses in mainland Europe.
Sam Markey met Avi Nardia in the USA. He introduced KAPAP to the United Kingdom and he was the first person authorized by Major Avi Nardia and Lt. Col. Chaim Pe'er to open an authorized KAPAP training center.
KAPAP Asia
KAPAP Federation Asia is headed by Master Teo Yew Chye (KAPAP Level 3 Instructor) and his training team on behalf of Major Avi Nardia and Lt. Col. Chaim Pe'er.
See also
- Krav Maga
- Sayeret Matkal (Special Forces Unit of Lt. Co. Chaim Pe'er, Head of the International KAPAP Federation)
- Yamam (Special Forces Police Unit)
References
- Jump up ^ KAPAP Worcester. KAPAP Worcester (2010-05-26). Retrieved on 2011-12-17.
- Jump up ^ Martial Arts Biography - Lt. Colonel Chaim Peer. Usadojo.com. Retrieved on 2011-12-17.
- Jump up ^ Dr. Dennis Hanover. Dennis-hisardut.org.il (2009-12-28). Retrieved on 2011-12-17.
Sources
- Palmach online Museum
- Historical Kapap site
- History of Lotar/Kapap
- Israel connection
- The Walking Stick in Mandatory Palestine and Israel
- Inside Israel Article by Black Belt Magazine
External links
Selbstbehauptung
Selbstbehauptung ist die Fähigkeit, sich nach außen hin (Soziale Interaktion) der eigenen Grenzen und Rechte bewusst zu sein und diese kommunizieren zu können.
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung
Die Selbstbehauptung auch: Ich-Beteiligung, Ego-Involvement, Ich-Bezug - bezeichnet die bewusste und unbewusste Bezugnahme eines Individuums zu situativen, personellen oder anderen Stimuli, die meist von zentraler Bedeutung für sein soziales Verhalten sind. Es ist ein allgemein beschreibender Begriff mit relativ hoher Unschärfe, da er das Konstrukt des Ich als außerordentlich komplexe Gegebenheit einschließt. Die Selbstbehauptung wird aufgefasst als Ausmaß des Selbstbezugs (als ein Teil der Motivation für ein bestimmtes Verhalten) oder auch als Grad der auf die eigene Person gerichteten bzw. vom eigenen Ich abhängigen Handlungstendenzen sowie als Umfang, in dem das Selbstkonzept, d. h. das Selbstbild, bei anderen psychischen Prozessen (siehe Wahrnehmungspsychologie, Denken, Handlung) mitbeteiligt bzw. mitbewusst ist. Diesen Auffassungen liegt die Vorstellung zugrunde, dass das "Ich" sowohl zentrale Instanz als auch zentralisierendes Organisationsprinzip ist. Als solches führt es über aktuell veränderte Einstellungen der Person zu sich selbst zu Aktivitäten, die die eigene Person zum Gegenstand haben bzw. in irgendeiner Weise Störungen des Selbstgefühls anzeigen oder regulieren.
Training
Sie wird über die Arbeit an häufig auftretenden, teilweise sogar alltäglich stattfindenden Konfliktsituationen trainiert und kann im Alltag kontinuierlich weiter eingeübt werden. Erfahrungsgemäß ist dies eine Grundvoraussetzung, um sich vor sexueller/sexualisierter Gewalt zu schützen. Die Erfahrungen in den Trainings zeigen außerdem, dass bei frühzeitigem Wahrnehmen und Einsetzen der Selbstbehauptungstechniken der Einsatz körperlicher Abwehrtechniken (Selbstverteidigung) oft nicht mehr erforderlich ist. Somit erklärt sich, warum Selbstbehauptung in den kombinierten Trainings den unverzichtbaren Basisteil darstellt.
Bewusste/ vorsätzliche Grenzverletzungen
Eine bewusste Grenzverletzung ist die intendierte Überschreitung der Intimsphäre einer Person, durch die Grundrechte (Menschen- und Bürgerrechte) berührt werden (Freiheit, Ehre, Gesundheit, Eigentum). Der Mensch, dem die Grenzverletzung widerfährt, muss sie als solche definieren, da die Intimsphäre bei jedem Menschen, bedingt durch seine Sozialisation, seine Erfahrungen, seine Wahrnehmung etc. unterschiedlich ist. Mit Grenzverletzungen sind keinesfalls nur Straftatbestände gemeint, auch das Hervorrufen eines unguten Gefühles in Alltagssituationen kann durchaus schon als Grenzverletzung empfunden werden.
Unbewusste Grenzverletzungen
Im Gegensatz zu der bewussten Grenzverletzung sind sie von der grenzverletzenden Person maximal bedingt vorsätzlich oder unbewusst herbeigeführt. Es gibt Situationen, in denen Betroffene solche Grenzverletzungen bewusst hinnehmen, da sie sich an den betreffenden Örtlichkeiten nicht vermeiden lassen (Enge im Fahrstuhl, Bus u. a.). Im Ergebnis lösen sie bei der von der Verletzung betroffenen Person die gleichen Emotionen aus wie bei den vorsätzlichen Grenzverletzungen, und hier können die Betroffenen sich natürlich auch dafür entscheiden, ihre Grenze deutlich zu machen. Im Vordergrund stehen in jedem Selbstbehauptungstraining Grenzverletzungen unterhalb eines körperlichen Angriffs, die Teilnehmer erlebt haben oder die ihnen alltäglich widerfahren können. Konzentrieren sich Teilnehmer darauf, wie sie sich bei der Konfrontation mit einem Gewalttäter verhalten können, setzen sie ihre eigene Messlatte oft so hoch, dass sie an ihrer Zielsetzung scheitern und handlungsunfähig werden. Trainieren die Teilnehmer aber ein selbstbewusstes Auftreten in alltäglichen Situationen, so wächst mit der erfolgreichen Lösung der Alltagsprobleme ihre Selbstsicherheit und sie sind in der Lage, auch schwierige Situationen überlegt und konsequent anzugehen.
Quelle
- Landeskriminalamt Niedersachsen - AG Standards polizeilicher Selbstbehauptungs-/ Selbstverteidigungstrainings
Kampfsport
Kampfsport ist im deutschsprachigen Raum der in der Öffentlichkeit (außerhalb der Fachkreise) benutzte Sammelbegriff für die vielen verschiedenen Kampfstile, vor allem solche, bei denen keine Schusswaffen verwendet werden. Besonders häufig wird der Begriff speziell mit der asiatischen Tradition des japanischen Budō, des chinesischen Kung Fu (eigentlich Wushu) oder des koreanischen Taekwondo verknüpft, obwohl es auch zahlreiche einheimische Kampfstile gibt. Zu den in Europa bekanntesten Kampfsportarten gehören Boxen, Karate, Judo und Ringen sowie lokal bedeutende Sportarten wie das schweizerische Schwingen oder das türkische Ölringen.
Inhaltsverzeichnis
Kampfsport und Kampfkunst
In Fachkreisen wird meistens eine genauere Differenzierung zwischen Kampfsport und Kampfkunst verwendet. Im Kampfsport steht demnach der reglementierte sportliche Wettkampf im Vordergrund, bei dem es darum geht, im Rahmen der Regeln zu gewinnen und besser zu sein als der Gegner. In den meisten Kampfsportarten werden keine Waffen verwendet, und wenn doch, dann nur Sportwaffen, die die Verletzungsgefahr verringern. Wettbewerbe im Kampfsport sind in der Regel Zweikämpfe, jedoch sind auch andere Wettbewerbsformen möglich.
Eine Kampfkunst hingegen befasst sich in der Regel mit Selbstverteidigung und dem Verhalten in echten, unreglementierten Gefahren- oder Konfliktsituationen. Daher enthält jede Kampfkunst Kampftechniken, die zum Ziel haben, einen Gegner zu besiegen, häufig auch unter der Verwendung von Waffen. Darüber hinaus gehören zu einer Kampfkunst häufig andere Aspekte, wie beispielsweise die Vermeidung von Konflikten im Vorfeld, die generelle Erhöhung der Beweglichkeit, Kraft, Geschwindigkeit oder Selbstdisziplin. Manche Kampfkunstsysteme, vor allem aus dem asiatischen Umfeld, sehen sich als vollständiges System der Lebensgestaltung oder Vervollkommnung mit entsprechendem philosophischem oder religiösem Unterbau, wie beispielsweise das japanische Budō. Vor allem heutzutage treten dabei die eigentlichen Kampftechniken bisweilen sogar in den Hintergrund oder werden nur als Weg zum eigentlichen Ziel verstanden. Wettbewerbe in den Kampfkünsten sind in der Regel keine Zweikämpfe.
Die Trennung zwischen Kampfkunst und Kampfsport ist nicht scharf. Von vielen Kampfkünsten gibt es auch Varianten, die den sportlichen Zweikampf erlauben (z. B. Karate). In anderen Kampfkünsten hingegen stehen sportliche Einzelwettbewerbe im Vordergrund (z. B. beim modernen Wushu), während der Aspekt der Selbstverteidigung und der echte Kampf in den Hintergrund tritt.
Ralf Pfeifer schlägt in seinem Buch "Mechanik und Struktur der Kampfsportarten - Handbuch für Trainer in Kampfsport und Kampfkunst"[1] folgende (nicht unumstrittenen) Unterscheidungskriterien vor.
| Kampfkunst | Kampfsport |
|---|---|
| Oberster Grundsatz: „Alles ist erlaubt, es gibt keine Regeln“, erfolgreiche SV-Techniken müssen keinem Regelwerk angepasst werden. | Oberster Grundsatz: „Die Sportkämpfer dürfen keine dauerhaften Schäden erleiden“. Der Sportkampf soll auch Spaß machen. |
| Der Kampf beginnt und wird solange fortgesetzt, bis einer der Gegner aufgibt (oder auch dazu nicht mehr in der Lage ist) oder sich dem Kampf entzieht. | Der Kampf wird von einem Dritten (Kampfrichter) entschieden. Es kommt mehr darauf an, den Kampfrichter von den eigenen Fähigkeiten zu überzeugen, als den Gegner zu besiegen. Heimliche Fouls werden daher gerne als Hilfsmittel für den Sieg eingesetzt. |
| Der Gegner hat immer Recht, wenn die von ihm angewendete Technik erfolgreich war. | Der Gegner kann Regelwidrigkeiten begehen, und kann trotz eines Sieges nachträglich disqualifiziert werden. |
| Wenn einer der Kämpfer überlegen ist, wird er diese Überlegenheit nutzen und bis zum Sieg weiterkämpfen. | Wenn einer der Kämpfer in eine überlegene Position gelangt, wird der Kampf in manchen Kampfsportarten unterbrochen und die Kämpfer dürfen wieder eine gleichwertige Ausgangsposition einnehmen. |
| Der Kampf wird zügig beendet, es gibt keine zweite Chance. | Der Kampf wird künstlich verlängert, jeder bekommt immer wieder eine neue Chance. Wer am Anfang schlecht ausgesehen hat, kann hinterher trotzdem Sieger werden. |
| Wenn das Opfer aufgibt, muss es trotzdem mit weiteren Angriffen rechnen, insbesondere dann, wenn der Angriff Teil eines Verbrechens ist. | Wenn ein Kämpfer aufgibt, sorgt der Schiedsrichter für das Ende des Kampfes und den sicheren Rückzug des unterlegenen Kämpfers. Nachschlagen oder treten nach dem Eingreifen des Ringrichters wird geahndet. |
| Das Technikprogramm umfasst nicht nur zweckmäßige SV-Techniken, sondern es muss auch die Abwehr von Angriffen geübt werden, die in Sportkampfstilen häufig und erfolgreich benutzt werden, da man sich den Gegner nicht aussuchen kann. | Das Technikprogramm ist regelorientiert. Es wird nur das geübt, was im Sportkampf auch Erfolg bringt. Es ist nicht nötig, andere Techniken zu üben, da Gegner und Reglement dem Kämpfer vorher bekannt sind. |
| Weder Gegner noch Austragungsort ist bekannt. Es ist nicht möglich eine individuelle Strategie oder Technik für einen bestimmten Gegner zu erarbeiten. | Der Gegner und Austragungsort des Kampfes ist Wochen oder Monate vorher bekannt. Es ist somit möglich, für jeden Gegner individuelle Strategien und Techniken zu erarbeiten, welche innerhalb des jeweiligen Regelwerks erlaubt sind. |
Wettkämpfe
Im Kampfsport sind vor allem zwei Arten von Wettkämpfen gebräuchlich: Zweikämpfe und Formwettkämpfe.
Zweikämpfe
Im sportlichen Zweikampf muss ein, in seltenen Fällen auch mehrere, Gegner besiegt werden. Je nach Sportart sehr unterschiedliche Kriterien können dabei zum Sieg führen:
- k.o. (z. B. beim Boxen)
- Niederschlag
- erfolgreiche Anwendung bestimmter Techniken (z. B. beim Karate)
- Immobilisierung des Gegners (z. B. beim Judo)
- Herauswerfen des Gegners aus dem Ring (z. B. beim Sumo-Ringen)
- Erzwingen der Aufgabe des Gegners, beispielsweise im Judo
- Bodenkontakt bestimmter Körperteile (z. B. beide Schultern beim Ringen, Schwingen)
In der Regel sind dabei bestimmte Techniken verboten, wie beispielsweise Stiche zu den Augen, Schläge in den Genitalbereich, oder Tritte, Würfe oder Hebeltechniken allgemein, und gehören auch nicht zum Ausbildungsprogramm der Sportart.
Auch der Ablauf des Zweikampfes kann stark reglementiert sein. In bestimmten Formen des Kumite beim Karate beispielsweise darf jeder der Gegner eine fest vorgegebene Anzahl von Angriffen durchführen, die der andere Gegner erfolgreich abwehren muss, um zu gewinnen.
Formwettkämpfe
In vielen fernöstlichen Kampfkünsten und -sportarten sind die häufigsten und bisweilen einzigen Wettkämpfe sogenannte Formwettkämpfe. Dabei führen die Kampfsportler einstudierte Bewegungsabläufe (z. B. Kata in den japanischen Kampfkünsten (Budō) oder Taolu in den chinesischen Kampfkünsten (Wushu)) vor, die anschließend von Schiedsrichtern bewertet werden. Dabei kann es sich um fest vorgegebene oder selbst erdachte Formen handeln, mit sehr unterschiedlicher Dauer und Bewegungsanzahl, die einzeln oder zu mehreren vorgeführt werden, synchron oder als choreographierter Kampf.
Wie bei anderen Sportarten fließen dabei verschiedene Kriterien in die Bewertung ein, wie z.B. die Schwierigkeit der Form, die Genauigkeit der Ausführung der verschiedenen Bewegungen, der Ausdruck usw.
Sofern überhaupt Wettkämpfe in den Kampfkünsten existieren, sind es in der Regel Formwettkämpfe.
Kampfkunst
Als Kampfkunst bezeichnet man Stile, die Fertigkeiten und Techniken der ernsthaften körperlichen Auseinandersetzung mit einem Gegner unterrichten. Dabei kann es sich um Regelwerke oder Unterrichtssysteme handeln. Im Gegensatz zur Kampfkunst steht der Kampfsport, bei dem es um den sportlichen Vergleichskampf geht.
In der Praxis findet man zahlreiche Stile, die eine Mischung aus Kampfsport und Kampfkunst sind und den Unterricht um weitere Aspekte wie Philosophie, Kultur, religiöse Elemente, Denkweise, Alltagsleben und Gesundheit erweitern.
Inhaltsverzeichnis
Begriff
Das Begriffselement Kampf kann je nach Tradition und Motiv jede der Bedeutungen annehmen, die mit dem Stammwort verbunden sind (siehe Kampf). Kunst ist hier, im Gegensatz zu ästhetischem Schaffen (Kunst) als Können beziehungsweise Fertigkeit zu verstehen. Daher erscheint der Begriff Kampfkunst als adäquate Übersetzung des lateinischen Begriffs „Ars Martialis“, „der Kunst des Mars“, dem römischen Kriegsgott (vgl. martialisch). Dieser Begriff findet sich in wenig abgewandelter Form in vielen Neusprachen, wie beispielsweise „Martial Arts“ (englisch), „Arts Martiaux“ (französisch), „Artes marciales“ (spanisch) oder „Arti Marziali“ (italienisch).
Geschichte
Traditionelle Kampfkünste sind oft mit dem Ziel entwickelt worden, die Ausübenden auf militärische Kampfeinsätze vorzubereiten. Daher werden in vielen traditionellen Kampfkünsten waffenlose und bewaffnete Disziplinen gelehrt. Der Umgang mit höher entwickelten Waffen ist in bestimmten Traditionen stark formalisiert worden, so zum Beispiel im japanischen Kyūjutsu, Kenjutsu, womit diese Stile den Erfordernissen einer militärischen Erziehung (Formaldienst) nachkommen, gleichzeitig aber keine reine Kampfkunst mehr sind.
In einigen Stilen hat sich die Gewichtung auf die charakterliche Entwicklung des Praktizierenden verlagert, wobei die Bezeichnung Kampfkunst nicht abgelegt wurde. Dabei entwickeln sie sich teilweise von der Einübung echter Gewaltanwendung weg, hin zu rituellen und spirituellen Praktiken, die auch der Selbstfindung oder -vervollkommnung dienen sollen.
Moderne Kampfkünste, sowie moderne Interpretationen der traditionellen Lehren, werden vor allem mit dem Ziel der körperlichen Ertüchtigung und der Selbstverteidigung ausgeübt. Teils steht hier auch der Sieg im Wettkampf als Ziel im Vordergrund, was wiederum die Abgrenzung zum Begriff des Kampfsports erschwert. Moderne Kampfkünste sind auch heutzutage in bestimmten Bereichen der Ausbildung von Militär- und Sicherheitskräften zu finden.
Kampfkunst und -sport in engerem Sinne
Kampfsport ist das Messen der eigenen Kampffähigkeit mit der eines Gegners nach feststehenden Regeln. Dabei steht der sportliche Aspekt im Vordergrund, d.h. es geht darum, unter Beachtung der Regeln, zu gewinnen und besser zu sein als der Gegner.
Im Gegensatz dazu gibt es bei der Ausübung von Kampfkunst sehr verschiedene mögliche Ziele, wie etwa die Vervollkommnung des eigenen Stils, der Selbstdisziplin und andere eher geistige Komponenten.
Kampfkünste nach kultureller und geographischer Herkunft
Kampfkünste haben sich überall dort entwickelt, wo Menschen Auseinandersetzungen mit anderen Menschen hatten. Die ältesten überlieferten Traditionen finden sich in Europa (zum Beispiel Pankration, Pale und Pygme im Altertum, und Liechtenauers Fechtschule im 14. Jahrhundert) und in Süd-, Südost- und Ostasien.
Viele asiatische Kampfkünste sind besonders stark ritualisiert und mit philosophischem und religiösem Denken und Handeln verbunden.
Siehe auch
Literatur
- Miyamoto Musashi: Das Buch der Fünf Ringe. Klassische Strategien aus dem alten Japan. Piper, 2006, ISBN 978-3-492-04962-7.
- Sunzi: Über die Kriegskunst / Sun Bin: Über die
Kriegskunst
- In der Übersetzung von Zhong Yingjie. Verlag Volkschina, ISBN 7-80065-508-3 (mit einer Übersetzung ins moderne Chinesisch)
- Überarbeitete Neuauflage 2007 ohne chinesischen Text. Verlag für fremdsprachige Literatur, Beijing, ISBN 978-7-119-04486-6.
- Florian Markowetz, Uschi Schlosser Nathusius: Kampfkunst als Lebensweg. Werner Kristkeitz Verlag, ISBN 3-932337-14-X. [1]
- Hanko Döbringer: Cod.HS.3227a. 1389, Germanisches Nationalmuseum Nürnberg
- Hans Talhoffer: Erster Gothaer Codex. 1443, Ms. Chart. A558, Forschungsbibliothek Gotha
- Peter von Danzig: Cod. 44 A 8 [Cod. 1449]. 1452, Biblioteca dell'Academica Nazionale dei Lincei e Corsiniana
- Siegmund Ringeck: Mscr. Dresd. C 487. 1452, Sächsische Landesbibliothek, Dresden
- Johannes Lecküchner: Cod. Pal. Germ. 430. 1452, Universitätsbibliothek Heidelberg
- Albrecht Dürer: HS. 26-232. 1512, Michigan State University, Albertina, Wien
- Ralf Pfeifer: Mechanik und Struktur der Kampfsportarten – Handbuch für Trainer in Kampfsport und Kampfkunst. Dissertation. Sportverlag Strauß, ISBN 3-939390-03-8. [2]
- Guido Sieverling: Das Kampflexikon – 150 verschiedene Kampfstile, Erklärungen und Waffen. Books on Demand, ISBN 978-3-8370-3564-3
Weblinks
- Ars Martialis Kampfkunst und Kampfsport aus Sicht der Wissenschaft
- Artikel Kampf des Lebens – Kampfkunst und Philosophie (PDF; 483 kB)
Hans-Gert Niederstein
Hans-Gert Niederstein (* 24. April 1928 in Oberhausen; † 12. November 1985) war ein Lehrer und Meister der Selbstverteidigung Jiu Jitsu und des Kampfsportes Judo. Weiterhin ist er ehemaliger Präsident der Korporation Internationaler Danträger e.V. (KID) und des Deutschen Jiu Jitsu Bundes e.V. (DJJB). Der im Alter von 57 Jahren verstorbene H.-G. Niederstein (Ehrentitel Hanshi, 10. Dan Jiu Jitsu, 2. Dan Judo) wies − als hochgraduierter Meister und Präsident beider Verbände − seinen Schülern den technisch-stilistischen und geistigen Weg und lebte diesen seinen Schülern vor. Er verstand es, sich körperlich und geistig zu vermitteln, und gab seinen Schülern weiter, was ihm zum zweiten Ich geworden war.
Inhaltsverzeichnis
Kampfsportliche Laufbahn
1948 begann Hans-Gert Niederstein mit dem Training im Jiu Jitsu und Boxen in Oberhausen unter Wilhelm Brinkmann, der im 2. Weltkrieg Nahkampfausbilder war. 1952 dann die Teilnahme Niedersteins am Jiu Jitsu Diensttraining der Sterkrader Nachkriegspolizei in Oberhausen unter Willi Schmitz, einem Oberhausener Polizisten und ehemaligen Schwergewichts-Boxer. Im Judoclub Hamborn 07 (Duisburg) begann Hans-Gert Niederstein 1953 mit dem Judotraining unter Walter Schombert (4. Dan Judo), dreifacher Deutscher Meister im Schwergewicht (1955, 1956, 1957[1]) und Bronzemedaillen-Gewinner der Europa-Mannschaftsmeisterschaften 1951[2][3]. Zusätzlich zum Training in Duisburg, besuchte Niederstein Lehrgänge beim DJB-Bundestrainer Tokio Hirano. 1955 gründete Hans-Gert Niederstein eine Sportabteilung im TUS 1887 Oberhausen-Altstaden. Dabei wurde er von seinem Judo-Trainer Walter Schombert unterstützt. 1960 zog er aus beruflichen Gründen nach Mülheim an der Ruhr und gründete im gleichen Jahr den Judo- und Jiu-Jitsu-Verein Bushido Mülheim e.V. Im Jahre 1972 gründete H.-G. Niederstein die KID, als Kommunikationsforum für Danträger, und drei Jahre später, 1975, den DJJB, als Verband für die Vereine der Danträger der KID. Testamentarisch bestimmte Hans-Gert Niederstein – nach seinem Tod 1985 − seinen langjährigen Trainingspartner Dieter Lösgen zu seinem Nachfolger und Präsidenten der Korporation Internationaler Danträger e.V. und des Deutschen Jiu Jitsu Bundes e.V.
Graduierungen [4]
Hans-Gert Niederstein legte 1960 − nach sieben Jahren Judotraining − den ersten Dan im Judo an der Sporthochschule Köln mit bester Note für den Teil "Selbstverteidigung", bei Kokichi Nagaoka, dem Bundestrainer Judo des Deutschen Judo Bundes (DJB), ab. Seinen 2. Dan im Judo erhielt er 1962 von Johan van der Brüggen (damals 6. Dan Judo) in den Haag (Niederlande), einem Schüler von Ichiro Abe aus Frankreich. Vor der gleichen Kommission legte er die Prüfung zum ersten Dan im Jiu Jitsu ab und erhielt diesen von Heinz Günter. 1964 bestand Hans-Gert Niederstein dann die Prüfung zum 2. Dan Jiu Jitsu bei dem Österreicher Wolfgang Somitsch (5. Dan Jiu Jitsu). Den 3. Dan bestand er mit Auszeichnung vor einer zehnköpfigen Prüfungs-Kommission in Frankfurt unter der Leitung von Heinz Günter. Wegen der zuvor mit Auszeichnung bestandenen Prüfung durfte H.-G. Niederstein nach nur zwei Jahren Wartezeit − anstatt von regulär vieren − zur Prüfung zum 4. Dan Jiu Jitsu antreten und legte diese erfolgreich vor der gleichen Prüfungskommission ab. Den 5. und 6. Dan bestand er bei Erich Rahn in Berlin. Der 7., 8. und 9. Meistergrad im Jiu Jitsu wurden in den nächsten Jahren ehrenhalber durch Dai-Sensei (jap. "großer Meister") Robert Tobler (10. Dan Jiu Jitsu) an H.-G. Niederstein verliehen. 1982 verlieh Robert Tobler (*1902; † 26. Mai 1983[5]) – kurz vor seinem Lebensende − Hans-Gert Niederstein den Ehrentitel Hanshi und den 10. Dan Jiu Jitsu, die höchste Meisterstufe im Jiu Jitsu. Diese höchste Graduierung war verbunden mit der Bitte Toblers an H.-G. Niederstein, dass er die Kampfkunst Jiu Jitsu weiter lehren und international verbreiten solle, falls Robert Tobler sterben würde.
Publikation
Unter dem Titel "Selbstverteidigung für Frauen: erfolgreiche Abwehr durch einfache Praktiken" hat Hans-Gert Niederstein ein Buch zum Thema Frauenselbstverteidigung verfasst. Dieses mit vielen Illustrationen untermalte Buch erschien ein Jahr nach dem Tod Niedersteins, im Jahre 1986, im Econ-Taschenbuch-Verlag. Zu beachten ist, dass der Vorname fälschlicherweise mit "d" statt mit "t" geschrieben worden ist.[6]
Pfinztal
| Wappen | Deutschlandkarte | |
|---|---|---|
 |
|
|
| Basisdaten | ||
| Bundesland: | Baden-Württemberg | |
| Regierungsbezirk: | Karlsruhe | |
| Landkreis: | Karlsruhe | |
| Höhe: | 151 m ü. NHN | |
| Fläche: | 31,05 km² | |
| Einwohner: | 17.664 (31. Dez. 2011)[1] | |
| Bevölkerungsdichte: | 569 Einwohner je km² | |
| Postleitzahl: | 76327 | |
| Vorwahlen: | 0721, 07240 | |
| Kfz-Kennzeichen: | KA | |
| Gemeindeschlüssel: | 08 2 15 101 | |
| Adresse der Gemeindeverwaltung: |
Hauptstraße 70 76327 Pfinztal |
|
| Webpräsenz: | ||
| Bürgermeisterin: | Nicola Bodner | |
| Lage der Gemeinde Pfinztal im Landkreis Karlsruhe | ||
Pfinztal ist eine Gemeinde im Landkreis Karlsruhe. Sie ist die einwohnerstärkste Gemeinde in Baden-Württemberg ohne Stadtrecht.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Geografische Lage
- 2 Gemeindegliederung
- 3 Nachbargemeinden
- 4 Geschichte
- 5 Einwohnerentwicklung
- 6 Religionen
- 7 Sehenswürdigkeiten
- 8 Politik
- 9 Markenzeichen der Gemeinde
- 10 Partnerschaften
- 11 Wirtschaft und Infrastruktur
- 12 Ehrenbürger
- 13 Söhne und Töchter der Gemeinde
- 14 Literatur
- 15 Einzelnachweise
- 16 Weblinks
Geografische Lage
Pfinztal liegt am Rande des Kraichgaus. Im Westen grenzt Pfinztal an die Stadt Karlsruhe und im Osten an den Enzkreis. Die Lage im Tal der Pfinz, einem Nebenfluss des Rheins, gab der Gemeinde ihren Namen. Die Region wird auch als „Pfinz-Kraichgau“ bezeichnet.
Naturraum
Die Gemeinde ist umgeben von Wäldern, Wiesen, Obst- und Rebhängen. Von der naturräumlichen Gliederung Deutschlands her gehört Pfinztal zur naturräumlichen Haupteinheit Nr. 125 (Kraichgau) und dort zur Untereinheit 125.2 (Kraich-Saalbach-Hügelland) im Südwestdeutschen Schichtstufenland gemäß der Systematik des Handbuchs der naturräumlichen Gliederung Deutschlands.
Gemeindegliederung
Die Gemeinde Pfinztal besteht aus den früher selbstständigen Gemeinden Berghausen, Kleinsteinbach, Söllingen und Wöschbach. Zu den ehemaligen Gemeinden Berghausen, Kleinsteinbach und Wöschbach gehören jeweils nur die gleichnamigen Dörfer. Zur ehemaligen Gemeinde Söllingen gehören das Dorf Söllingen und die Häuser der Badischen Wolframerzegesellschaft (vormals „Hammerwerk“).
In den vier ehemaligen Gemeinden sind Ortschaften im Sinne der baden-württembergischen Gemeindeordnung mit jeweils eigenem Ortschaftsrat und Ortsvorsteher als dessen Vorsitzender eingerichtet.
Im Gebiet der ehemaligen Gemeinde Berghausen liegen die Wüstungen Hefingen, Salchhofen und Sluchelingen. Im Gebiet der ehemaligen Gemeinde Söllingen deutet der Flurname Kalkofen auf eine heute nicht mehr existierende Siedlung hin.[2]
Nachbargemeinden
An Pfinztal grenzen die Gemeinden Walzbachtal, Weingarten (Baden), Karlsbad (Baden), Remchingen, Königsbach-Stein und die Stadt Karlsruhe.
Geschichte
Im Oktober 1969 legte die Dichtel-Kommission dem baden-württembergischen Innenministerium ein Gutachten vor, wonach die Gemeinden die Auswahl zwischen zwei Modellen hatten: 1. Zusammenschluss mehrerer Gemeinden zu einer Einheitsgemeinde (Zuschuss = 30 DM/Kopf) oder 2. die Bildung einer Verwaltungsgemeinschaft von mehreren Gemeinden bei Wahrung der Eigenständigkeit (Zuschuss = 7 DM/Kopf). Ende 1972 ließ die Landesregierung anklingen, dass sich die vier Gemeinden Berghausen, Kleinsteinbach, Söllingen und Wöschbach bis zum 30. Juni 1973 zum Zusammenschluss zu einer Einheitsgemeinde einigen sollten, da – nur dann – die in Aussicht gestellten Fusionsprämien (ca. 8 Millionen DM) gezahlt werden würden. Am 7. Juni 1973 wurde der Fusionsvertrag von den Bürgermeistern im Emil-Frommel-Haus in Söllingen unterzeichnet.
So wurde Pfinztal im Rahmen der Gemeindereform zum 1. Januar 1974 durch Vereinigung der vier Gemeinden gebildet.
Der Zusammenschluss machte die Umbenennung einiger Straßen notwendig.
Die erhaltene Fusionsprämie wurde entsprechend dem Fusionsvertrag eingesetzt. Der größte Teil floss in das Bildungszentrum. Mit dem Rest wurden die Wunschkataloge der vier Ortsteile abgearbeitet.
Ortsteile
Berghausen
Mit rund 7300 Einwohnern ist Berghausen der größte Ortsteil. Dementsprechend befinden sich dort auch viele wichtige öffentliche Einrichtungen, welche der Gesamtgemeinde dienen. Wie zum Beispiel das Bildungszentrum Pfinztal mit Gymnasium, Realschule, Werkrealschule, Grund- und Hauptschule direkt an der Stadtbahnlinie Karlsruhe-Pforzheim.
Berghausen wurde erstmals im Jahre 771 nach Christus erwähnt, als ein gewisser Herolt dem Kloster Lorsch einen Weinberg von barchûsen (Häuser bei den Heustadeln) schenkte. Allerdings wurde ein Schädeldach und Kieferteile eines Menschen aus der Altsteinzeit und Steingeräte und Tongefäße aus der Jungsteinzeit gefunden. Berghausen ist somit nach Bretten der zweitälteste Ort im Landkreis Karlsruhe.
Wie schon im Dreißigjährigen Krieg wurde Berghausen auch während der Pfälzischen Kriege (1688 bis 1697) stark in Mitleidenschaft gezogen.
1859 fuhren die ersten Eisenbahnzüge durch Berghausen. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts siedelten sich in Berghausen erstmals Unternehmen der Industrie an. Diese Entwicklung wurde durch den Ersten Weltkrieg unterbrochen. Berghausen hatte als Folge des Zweiten Weltkrieges von 1939 bis 1945 viele Kriegsopfer zu verzeichnen.
Kleinsteinbach
Mit seinen rund 2300 Einwohnern ist Kleinsteinbach der kleinste Ortsteil von Pfinztal.
Kleinsteinbach wurde 1328 erstmal urkundlich als Niedern Steinbach erwähnt. Vom 14. bis in das 16. Jahrhundert verfügten die Herren von Remchingen als Lehnsleute der badischen Markgrafen über Kleinsteinbach. 1692 wurde der Ort im Zuge eines Krieges mit Frankreich nahezu komplett verwüstet und ausgeplündert.
Bis ins 19. Jahrhundert war Kleinsteinbach mit Ausnahme einiger Handwerks- und Steinbruchbetriebe ein Bauerndorf. Dies änderte sich mit dem Eisenbahnbau 1859. Heute findet man in der Ortschaft eine Grundschule, eine Privatschule, zwei Kindergärten und Einkaufsmöglichkeiten für den täglichen Bedarf.
Söllingen
Söllingen (5500 Einwohner) ist der Sitz der Gemeindeverwaltung von Pfinztal. In der Ortsmitte ist die Verwaltung in drei Gebäuden untergebracht. Flächenmäßig ist Söllingen der größte Ort der Gemeinde. Genau wie Berghausen und Kleinsteinbach ist Söllingen an der Stadtbahnstrecke Karlsruhe-Pforzheim (mit 3 Haltestellen) angeschlossen.
Die erste urkundliche Erwähnung stammt aus dem Jahr 1085. 2010 feierte Söllingen deshalb sein 925jähriges Bestehen. Im 12. Jahrhundert war Söllingen im Besitz der Klöster Gottesau, Herrenalb und Hirsau. Im 16. Jahrhundert ging der Ort an die Markgrafschaft Baden. 1867 entstand die Bahnverbindung zwischen den Städten Karlsruhe und Pforzheim. Im gleichen Zug erhielt Söllingen einen Bahnhof.
Das Gewerbe und später die Industrie gewannen im 19. Jahrhundert große Bedeutung für die Gemeinde. An der Gemarkungsgrenze zu Kleinsteinbach entstand ein für die damalige Zeit bedeutendes Industrieunternehmen, das Wolframwerk. Die Metallindustrie, die sich insbesondere im benachbarten Durlach angesiedelt hatte, gab auch den Bewohnern von Söllingen neue Verdienst- und Arbeitsmöglichkeiten. Rund 800 Heimatvertriebene fanden nach dem Zweiten Weltkrieg in Söllingen eine neues Zuhause.
Wöschbach
Der Ortsteil Wöschbach (2800 Einwohner) ist über Berghausen zu erreichen und liegt abseits der Hauptverkehrsstraßen im Wöschbacher Tal. Wöschbach wurde im 13. Jahrhundert erstmals urkundlich erwähnt. Wöschbach blieb vom Deutschen Bauernkrieg und von der Reformation unberührt. Im Verlauf des Dreißigjährigen Krieges und in den Kriegsjahren 1691–1693 verlor es fast die gesamte Bevölkerung.
In den beiden Weltkriegen starben viele Einwohner, öffentliche Gebäude und Wohnhäuser wurden zerstört. Etwa 400 Heimatvertriebene fanden nach Ende des Zweiten Weltkrieges in Wöschbach ein neues Zuhause. Zu diesem Zeitpunkt hatte Wöschbach etwa 1200 Einwohner. Die Bautätigkeit nahm nach Kriegsende stark zu.
Einwohnerentwicklung
Religionen
43,9 % der Bevölkerung in Pfinztal ist protestantisch. 26,8 % römisch-katholisch. Daneben verfügen auch die evangelische Liebenzeller Gemeinschaft, die Neuapostolische Kirche, die evangelisch-freikirchliche Christusgemeinde und die AB Gemeinschaft über Gemeinden in den einzelnen Ortsteilen.
Pfinztal ist Sitz des Dekanats Alb-Pfinz (Kirchenbezirk) der Evangelischen Landeskirche in Baden. Die mit der politischen Gemeinde Pfinztal deckungsgleiche katholische Seelsorgeeinheit Pfinztal gehört zum Dekanat Pforzheim des Erzbistums Freiburg. Die neuapostolischen Gemeinden der vier Ortsteile gehören zum Kirchenbezirk Söllingen der Neuapostolischen Kirche Süddeutschland.
Sehenswürdigkeiten
Bauwerke
Kirchen
Im Ortsteil Kleinsteinbach steht eine Kirche des Weinbrenner-Klassizismus in Baden. Sie wurde von 1806 bis 1817 von Friedrich Weinbrenner selbst entworfen.
Die Martinskirche in Berghausen war ursprünglich ein Wehrturm im romanischen Baustil. Das kleine schmale Fenster an der Nordostseite wurde nachträglich im spätgotischen Stil eingefügt, aus gleicher Zeit ist der Wandtabernakel (vor 1356) im Inneren des Turms. Im Jahre 1754 wurde das ehemalige spitzere Dach in diese Form gebracht. 1862 wurden die Hohlziegel durch schwarzen Schiefer ersetzt. Als die Kirche 1961 zu klein und zudem sanierungsbedürftig wurde, hat man das alte Kirchenschiff abgerissen. Dabei fand man einige Münzen (die älteste von 1277) und viele alte Grundmauern und Gräber. Die Abdeckplatte eines Grabes war aus dem Bruchstück einer römischen Türschwelle. Der neue Grundriss des Gotteshauses, ein langgezogenes Sechseck stammt von Architekten G. Einwächter, bietet 660 Sitzplätze und wurde 1962 seiner Bestimmung übergeben.
Brunnen
In Pfinztal stehen verschiedene Brunnen. Einer davon ist z. B. der Storchbrunnen in Berghausen, dessen Brunnentrog um 1828 erbaut wurde und der damit der älteste erhaltene Brunnen in Pfinztal ist. Außerdem gibt es in Berghausen einen Brunnen „Alter Friedhof“, den Bahnhofsplatzbrunnen, den Dorfbrunnen an der Oberlinstraße Ecke Kelterstraße und den 2000 erbauten Löwenbrunnen, dessen Löwe von einer Brunnensäule des ehemaligen Wasserschlosses von Berghausen stammt.
Der neueste Brunnen in Berghausen ist die Wasserwand am Europaplatz. Er wurde 2002 vom Architekten Gekehler & Bäuerlein erbaut.
Etwas jünger ist der Alte Dorfbrunnen in Kleinsteinbach. Er ist der einzige Brunnen in Kleinsteinbach. Er wurde etwas vor 1911 erbaut. Der Künstler ist nicht bekannt.
Im Jahr 1986/87 wurde in Söllingen der Krottenlachbrunnen angelegt. Direkt neben dem Rathaus befindet sich der 1992 eingeweihte Rathausbrunnen. Außerdem gibt es in Söllingen noch den Hirschtalbrunnen, den Alten Dorfbrunnen und den Brunnen am Bürgerhaus.
Der Maurerbrunnen und der Ölfunzelbrunnen in Wöschbach gehören zu den neuesten Brunnen in Pfinztal. Sie wurden 2002/03 im Auftrag der Gemeinde Pfinztal von Friedhelm Zilly erbaut. In Wöschbach ist außerdem noch ein Brunnen am Beginn des Kreuzwanderweges zu finden.
Gedenkstätten
Seit 1985 trägt das Gymnasium den Namen Ludwig Marums. Auch ein Denkmal der Bildhauerin Mariella Hanstein erinnert an den sozialdemokratischen Stadtrat und späteren badischen Justizminister, der als Hitler-Gegner 1934 im KZ Kislau ermordet wurde.[3]
Touristische Straßen
Bertha Benz Memorial Route
Durch Pfinztal führt die Bertha Benz Memorial Route (Mannheim-Pforzheim-Mannheim). Sie erinnert an die erste Automobile Fernfahrt der Geschichte im Jahr 1888, bei der Bertha Benz mit ihren beiden Söhnen auf der Hinfahrt auch Berghausen, Söllingen und Kleinsteinbach passierte.
Natur-Erlebnis-Pfad Pfinztal (NEPP)
Der Naturerlebnispfad im Ortsteil Söllingen möchte die Begegnung mit der Natur fördern. Der Pfad ist ein Rundweg mit derzeit 16 Stationen durch den Wald.
Skulpturenweg
Der Pfinztaler Skulpturenweg ist seit 2001 geöffnet. 23 Künstler stellen auf dem Weg aus. In regelmäßigen Abständen finden organisierte Führungen statt.
Kreuzwanderweg
Der Kreuz-Wanderweg um Wöschbach führt seine Besucher an verschiedenen Typen der Straßen-, Andachts-, Wege- und Feldkreuze vorbei. Ähnlich viele Steinkreuze befinden sich auch in der Nachbargemeinde Jöhlingen.
Früher wurde ein erheblicher Teil der Eigenversorgung durch intensiven Anbau der dorfnahen Feldfluren erzeugt. Hier wurde auch zu den Tageszeiten, die vom Geläut der Kirchenglocken angezeigt wurden, gebetet. Die Arbeit ruhte so lange auf dem Feld, bis der Engel des Herrn oder das Abendgebet gesprochen war. Das religiöse Leben der Kirchengemeinde war viel mehr am Jahreslauf angelehnt als heute. Besonders in katholischen Landen wurden im Verlauf des 19. Jahrhunderts viele Straßen- und Feldkreuze errichtet – gestiftet meist von einflussreichen Familien im Dorf.
Der Weg in die nächste Gemeinde oder Stadt kam früher meist einer Tagesreise gleich. Da war Gottes Segen für glückliche Rückkehr ebenso nötig wie die Schutzbitte vor den Gefahren des Weges. Wegekreuze stehen oft an der Gemarkungsgrenze zur Nachbargemeinde an alten Verbindungswegen, die zu Fuß oder mit Vieh und Wagen zurückgelegt wurden. Wegekreuze haben zwei Funktionen: Sie sind Zeichen des Abschieds beim Verlassen der Heimat und Zeichen des Willkommens bei der Heimkehr. An dieser Stelle werden Bitten und Dank ausgesprochen.
Weinstraße Kraichgau-Stromberg
Die Weinstraße Kraichgau–Stromberg führt auch durch Pfinztal.
Rundwanderweg Pfinztalpforte
Beginnend am Niddaplatz in Grötzingen führt dieser Wanderweg zunächst unter einer Brücke des Fraunhofer-Institutes hindurch zur 1996 gepflanzten Gerhard-Musgnug-Eiche und zur Berghausener Saatschulhüte. Weiter geht es über den Buchenwald nach Jöhlingen. Nach einem Besuch bei der Maria-Hilf Kapelle führt der Weg nach Wöschbach. Es folgt ein kurzer Abstecher nach Söllingen. Über den auf Karlsruher Gemarkung liegenden Ritterhof geht es wieder zurück nach Grötzingen. Das Wegzeichen ist ein orangefarbener Strich.
Heimatmuseum
Das Heimatmuseum Pfinztal befindet sich im Bürgerhaus in Pfinztal-Söllingen. Es wird darin die Frühgeschichte von Pfinztal und auch die Entstehung der Gemeinden dokumentiert. Von Landwirtschaft über Handwerk bis hin zur Industrie wird das Leben im 18. und 19. Jahrhundert dargestellt.
Politik
Gemeinderat
Dem Gemeinderat gehören nach der Kommunalwahl vom 7. Juni 2009 neben dem Bürgermeister als Vorsitzenden 22 (vorher 25) Mitglieder an. Im Einzelnen ergab die Wahl folgendes Resultat:
- CDU: 9 Sitze (–4)
- SPD: 6 Sitze (–1)
- GRÜNE: 4 Sitze (+1)
- ULiP (Unabhängige Liste Pfinztal): 2 Sitze (±0)
- FDP: 1 Sitz (+1)
Seit der Gemeinderatswahl im Jahr 2009 gibt es in Pfinztal keine unechte Teilortswahl mehr.
Ortschaftsräte
In allen Ortsteilen gibt es Ortschaftsräte mit je 6 Mitgliedern und einen Ortsvorsteher. Die derzeitigen Ortsvorsteher der Ortschaften sind:
| Berghausen: | Harald Becker (CDU) |
| Kleinsteinbach: | Barbara Schaier (CDU) |
| Söllingen: | Tilo Reeb (SPD) |
| Wöschbach: | Otmar Bittner (CDU) |
Bürgermeister
| 1974–1996: | Gerhard Mussgnug |
| 1996–2012: | Heinz E. Roser |
| seit 2012: | Nicola Bodner |
Markenzeichen der Gemeinde
Wappen
Bei der Gestaltung des Gemeindewappens Pfinztal wurde besonderen Wert darauf gelegt, dass „ein die 4 Ortsteile verbindendes Symbol“ im Mittelpunkt steht. Dieses Verbindungssymbol bildet der silberne Brückenbogen. Damit wird an die in Berghausen und Söllingen noch vorhandenen und in Kleinsteinbach in den 50er Jahren abgebrochenen Bogenbrücken aus Sandstein über Pfinz und Bocksbach erinnert.
Das „Blau“ unter dem Brückenbogen soll die Pfinz symbolisieren, deren Tal bei der Namensfindung der Gemeinde Pfinztal Pate stand. Der vordere obere Teil zeigt das badische Landeswappen, wodurch die Zugehörigkeit der ehemals selbstständigen Gemeinden Berghausen, Söllingen, Kleinsteinbach und Wöschbach zum Land Baden verdeutlicht werden soll. Das in der hinteren oberen Hälfte dargestellte, geschliffene silberne Kreuz auf blauem Grund soll im Gedächtnis behalten, dass der Ortsteil Wöschbach bis zum Jahre 1803 zum Domkapitel Speyer gehörte.
Die heraldische Beschreibung des Wappens der Gemeinde Pfinztal lautet: In geteiltem Schild oben gespalten, vorn in gold ein roter Schrägbalken, hinten in blau ein geschliffenes silbernes Kreuz, unten in blau ein silberner Brückenbogen.
Pfinztaler Logo
Seit über 15 Jahren führt die Gemeinde Pfinztal zusätzlich zu ihrem Wappen das Pfinztaler Logo. Das Logo darf nur mit dem Zusatz des Namens der Gemeinde Pfinztal verwendet werden.
Die vier Punkte symbolisieren die vier Ortschaften Berghausen, Söllingen, Wöschbach und Kleinsteinbach. Sie sind in einem „P“ angeordnet, dass für Pfinztal steht.
Der grüne Bogen auf der rechten Seite steht für den Naturraum Pfinztal, Wald und Landschaft. Der blaue Bogen links steht für die der Gemeinde namensgebende Pfinz.
Die Kreisform des Logos soll die Gemeinschaft, die aus den vier ursprünglichen Gemeinden entstanden ist symbolisieren.
Das Gemeindemaskottchen „Pfinzi“
Das Maskottchen der Stadt Pfinztal soll dazu beitragen, dass die Menschen in den Ortsteilen noch mehr zusammen wachsen und alte Berührungsängste ablegen. Der Name „Pfinzi“ wurde im Rahmen eines Wettbewerbs, an dem über 80 Vorschläge bei der Gemeinde eingingen, von einer Jury ausgewählt.
Ein Drache deshalb, weil die Fläche der bebauten Gebiete in Pfinztal dem Fabelwesen ähnelt. Schaut man die Landkarte von Pfinztal an, so kann man erkennen, dass Berghausen, Söllingen und Kleinsteinbach über die Pfinz, die quasi das Rückgrat des Drachens bildet, als Drachenkopf, Körper und Beine verbunden sind. Auch Wöschbach hat seine Bedeutung in dieser Interpretation: als Flügel, der bei einem Drachen nicht fehlen darf.
Partnerschaften
Pfinztal unterhält partnerschaftliche Beziehungen zu
- Leerdam in den Niederlanden seit 1988 und
- Rokycany in Tschechien seit 1998.
Zum Zeichen der Verbundenheit – neben zahlreichen gegenseitigen Besuchen – wurde im Ortsteil Söllingen der Festplatz zum „Leerdamplatz“ umbenannt, im Ortsteil Kleinsteinbach ziert der in den Skulpturenweg integrierte „Rockycanyplatz“ auf dem Gelände der ehemaligen „Dreschhall“ das Ortsbild.
Wirtschaft und Infrastruktur
Wirtschaft
An Erwerbszweigen sind in Pfinztal Gastronomie (besonders hervorzuheben ist hier die „Villa Hammerschmiede“ in Kleinsteinbach) und etwas Industrie (Metall und Chemie) vertreten. Die Gemeinde ist bekannt als Sitz des Fraunhofer-Instituts für Chemische Technologie (ICT). Daneben liegt ein gewerbegebiet für Forschungs- und Entwicklungsfirmen.
Verkehr
Pfinztal liegt unter anderem an den Bundesstraßen B 10 (Lebach–Augsburg) und B 293 (nach Heilbronn) Die Anwohner der B 10 setzten sich für Tempo 30 in ganz Pfinztal ein – mit ersten Erfolgen. So wurde die Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h im Ortsteil Berghausen nun auch an der Bundesstraße 10 durchgesetzt – und auch auf der B 293 gilt seit kurzem Tempo 30.
Seit 1. Januar 2010 ist in Pfinztal eine Umweltzone eingerichtet, die das gesamte Gemeindegebiet – also alle vier Teilorte – umfasst. Die Bundesstraßen liegen somit auch in der Umweltzone.
Berghausen, Söllingen und Kleinsteinbach liegen an der Bahnstrecke Karlsruhe–Mühlacker–Stuttgart und sind mit der darauf verkehrenden S5 der Stadtbahn Karlsruhe im Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) an das Netz des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) angebunden. Sie fährt umsteigefrei in die Karlsruher Innenstadt und nach Pforzheim. Wöschbach ist von Berghausen aus mit der Buslinie 151 (AVG) angebunden. Des Weiteren existiert in Berghausen eine Haltestelle der Stadtbahnlinie S4 des KVV. Von Kleinsteinbach aus gibt es die Buslinie 152 (AVG) nach Karlsbad (Baden).
Medien
Das kostenpflichtige amtliche Mitteilungsblatt „Pfinztal Aktuell“ erscheint jeden Donnerstag. Es konzentriert sich auf Mitteilungen und Berichte der Gemeindeverwaltung sowie der örtlichen Vereine, Kirchen und Parteien.
Aktuelle Informationen finden sich aber auch auf der Homepage der Gemeinde Pfinztal.
Bildung
In Pfinztal ist die gesamte Breite des dreigliedrigen Schulwesens vorhanden: Berghausen verfügt mit dem Ludwig-Marum-Gymnasium, der Geschwister-Scholl-Realschule und der Schlossgartenschule (Grund, Haupt- und Werkrealschule) über ein breit gefächertes Bildungsangebot. In Söllingen besteht eine Grund- und Hauptschule. In Kleinsteinbach und Wöschbach gibt es reine Grundschulen. Außerdem gibt es mit der Aloys Henhöfer-Schule in Kleinsteinbach eine Freie evangelische Bekenntnisschule. Diese besteht aus Grund- und Förderschule sowie im weiterführenden Bereich Werkrealschule, Realschule und Gymnasium und bietet damit ebenfalls alle Schulabschlüsse.
Darüber hinaus gibt es sechs evangelische, drei römisch-katholische, einen kommunalen Kindergarten sowie ein vielfältige Hort- und Betreuungsangebot der Gemeinde.
Öffentliche Einrichtungen
Pfinztal besitzt viele gemeindeeigene Veranstaltungsräume, wie z. B. das Bürgerhaus, die Pfinztalhalle und die Julius-Hirsch-Halle in Berghausen, die Hagwaldhalle in Kleinsteinbach, die Räuchle-Halle in Söllingen und die Mehrzweckhalle in Wöschbach.
Im Selnitzsaal auf dem Europaplatz in Berghausen finden regelmäßig Veranstaltungen der Pfinztaler Gremien statt.
Sport und Freizeit
Als erfolgreicher Sportverein in Pfinztal ist der KSV Berghausen zu nennen. Die Ringer des Kraftsportvereins sind in der Regionalliga und in der Verbandsliga vertreten und haben eine erfolgreiche Jugendmannschaften.
Ebenfalls sehr erfolgreich sind die Turner des TG Söllingen. Die Kunstturner wurden 2012 Meister der Bezirksliga Nord und durften sich über den Aufstieg in die Landesliga freuen.
Im Musikbereich hat Pfinztal mehrere Musikverein, Gesangsvereine und Chöre, und auch im Natur- und Tierschutz sind viele Einwohner in Vereinen organisiert.
Ehrenbürger
- Gerhard Mußgnug † (ehem. Bürgermeister)
- Olga-Marie Freifrau von Gemmingen-Guttenberg (1916–1990)
- Franz Schäfer
- Rolf Wagner
Söhne und Töchter der Gemeinde
- Otto Seidenadel (1866–1918), geboren in Berghausen, Jurist, badischer Oberamtmann
- Magdalena (Anna Maria) Becker (*1659–†1745), Urgroßmutter von Friedrich Hölderlin, stammte aus dem Gasthaus „Laub“ in Berghausen
- Karl Langenstein (25. Juli 1926 in Kleinsteinbach; † 28. Mai 2008), Künstler aus Kleinsteinbach
Literatur
Gemeinde Pfinztal (Hg.): Pfinztal. natürlich – liebenswert – modern. Ubstadt-Weiher: verlag regionalkultur, 2007. ISBN 978-3-89735-258-2
Einzelnachweise
- Hochspringen ↑ Statistisches Bundesamt – Gemeinden in Deutschland nach Bevölkerung am 31.12.2011 auf Grundlage des Zensus 2011 und früherer Zählungen (XLS-Datei; 2,0 MB) (Einwohnerzahlen auf Grundlage des Zensus 2011) (Hilfe dazu)
- Hochspringen ↑ Das Land Baden-Württemberg. Amtliche Beschreibung nach Kreisen und Gemeinden. Band V: Regierungsbezirk Karlsruhe Kohlhammer, Stuttgart 1976, ISBN 3-17-002542-2. S. 112–114.
- Hochspringen ↑ Gedenkstätten für die Opfer des Nationalsozialismus. Eine Dokumentation, Bd. I, Bonn 1995, S. 68, ISBN 3-89331-208-0.
- Hochspringen ↑ http://www.statistik.baden-wuerttemberg.de/Wahlen/Kommunalwahlen_2009/GTabelle.asp?G=GE215101
Weblinks
- Internetpräsenz der Gemeinde.
- Bildergalerie der Gemeinde.
- zuzuku – moderne Skulpturen – Informationen zum Pfinztaler Skulpturenweg.
- Kleinsteinbachs Kirche auf einer privaten Webseite.
Taschenlampe
Eine Taschenlampe ist eine kleine, mobile Lichtquelle mit eigener Energieversorgung. Der Name entstand, da die meisten Taschenlampen klein genug sind, um in einer Tasche verstaut werden zu können.
Die Taschenlampe wurde 1899 vom Engländer David Misell erfunden, der das Patent an die Firma American Electrical Novelty and Manufacturing Company (heute bekannt als Energizer) verkaufte.[1] In Deutschland erhielt Paul Schmidt ein Patent auf eine elektrische Taschenlampe, das auf das Jahr 1906 zurückgeht. Er erfand diese jedoch schon kurz nach seiner Trockenbatterie, mit Mehl als Elektrolyt, im Jahre 1896.
Inhaltsverzeichnis
Aufbau und Funktion
Taschenlampen sind Leuchten in einer speziellen Bauart. Sie dienen als Umgebung für das eigentliche Leuchtmittel, die Lampe. Daher lautet der lichttechnisch korrekte Begriff Taschenleuchte.[2]
Eine Taschenlampe liefert üblicherweise einen engen Lichtkegel. Das Leuchtengehäuse besteht aus einem länglichen, oft runden Griffstück, in das mittels eines Schraub- oder Schiebeverschlusses am Ende Batterien oder Akkus eingesetzt werden. Um Lampen mit einem höheren Lichtstrom einsetzen zu können, werden mehrere Batteriezellen in Reihe geschaltet, häufig zwei oder vier Mignon- (Größe AA) oder Microzellen (AAA). Bei größeren Taschenlampen werden oft Baby- (C) oder Monozellen (D) verwendet. Sowohl Primärzellen als auch Akkumulatoren kommen zum Einsatz.
Am vorderen Ende befindet sich eine transparente Glas- oder Kunststoffscheibe, bei hochwertigen Lampen werden meist speziell beschichtete Gläser eingesetzt, um die Lichtdurchlässigkeit zu erhöhen. Hinter der Scheibe befindet sich die Lichtquelle (Glühlampe oder Leuchtdioden), die wiederum zur optimalen Lichtausbeute von einem Parabolspiegel umfasst ist, dem Reflektor. Der Reflektor und die Scheibe entfallen bei einfachen Lampen mit Leuchtdioden niedriger Leistung meist, da hier ein Reflektor und eine Fokussierlinse bereits in das Diodengehäuse integriert sind. Der Spiegel besteht aus Metall oder Metall-beschichtetem Plastik. Bei Lampen mit einer einzelnen Hochleistungs-LED werden statt eines Spiegels auch optische Systeme eingesetzt, die auf Totalreflexion basieren. Diese Optiken werden meist aus transparentem Kunststoff, sehr selten auch aus hochwertigem Glas hergestellt. Normalerweise hat der Bereich um das Leuchtmittel einen größeren Durchmesser als das Griffstück, da ein größerer Reflektor eine engere Bündelung des Lichts und somit eine höhere Leuchtweite bei gleicher Lichtleistung erlaubt. Für Glühlampen mit besserer Lichtausbeute werden mit den Edelgasen Xenon, vor allem aber Krypton gefüllte Halogen-Glühlampen eingesetzt, die das Verdampfen des Glühfadens hemmen und die Lebensdauer des Leuchtmittels erhöhen. Somit kann die Glühlampe mit höherer Leistung betrieben werden, was den Wirkungsgrad zum Teil erheblich steigert, und trotzdem akzeptable Betriebsdauern erreichen.
Bei Taschenlampen mit Kunststoffgehäuse sind zwischen Stromquelle, Schalter und Lichtquelle elektrische Leitungen nötig, bei Metallgehäusen wird häufig dieses selbst als einer der Leiter verwendet. Die Stromquelle berührt dabei mit einem Pol direkt die Lichtquelle und mit dem anderen das Gehäuse, welches über einen Schalter mit dem zweiten Anschluss der Lampenfassung verbunden ist.
Qualitätsmerkmale
Billige Taschenlampen sind oft nicht bruchfest, die Kontakte korrodieren in feuchter Luft oder durch Batterieflüssigkeiten, der Reflektor ist falsch geformt, die Lampen verbrauchen viel Energie und geben wenig Licht. Häufig haben die Metallteile schlecht miteinander Kontakt, so dass die Lampe nur wenig Licht liefert.
Die lichttechnischen Leistungsdaten, wie der Lichtstrom, gemessen in Lumen oder die Lichtfarbe, gemessen in Kelvin sind bei den wenigsten Taschenlampen angegeben. Vorhandene Angaben, vor allem die Leuchtweite und die Leuchtdauer mit einem Satz Batterien, sind oft stark übertrieben. Bei Verwendung einer Glühlampe als Leuchtmittel ändert sich die Lichtfarbe mit sinkender Spannung der Zellen durch die Entladung während des Betriebs stark, während die Helligkeit sinkt. Bei Verwendung von LEDs ändert sich die Lichtfarbe in der Regel nicht merklich, lediglich die Helligkeit sinkt. Während Glühlampen, wenn die Batterien entladen sind, zunächst dunkler werden und recht bald komplett erlöschen, können viele LED-Lampen noch lange mit niedriger Helligkeit weiterleuchten. Die Helligkeit liegt am Ende der Entladung oft unter einem Prozent der Helligkeit mit frischen Batterien. Einige Hersteller nutzen das, um eine extrem lange Leuchtdauer von mehreren hundert Stunden pro Batteriesatz auf die Verpackung zu drucken, ohne zu erwähnen, dass die Lichtleistung zu diesem Zeitpunkt zwar noch nutzbar ist, aber mehrere Größenordnungen unter der beworbenen Maximalleistung liegt. Taschenlampen mit elektronischer Stabilisierung der Helligkeit durch Regelung der Lampenspannung (Glühlampen) bzw. des Lampenstroms (LEDs) werden in den unteren Preiskategorien nicht angeboten.
Ausführungsformen
Einfache Taschenlampen werden meist im Spritzgussverfahren aus Kunststoff gefertigt und in der Tütenbauweise montiert. Ebenso gibt es Taschenlampen, deren Korpus aus einem Blechrohr besteht. Kunststofflampen sind weit verbreitet und werden auch als Werbegeschenk verteilt, können aber bei guter Verarbeitung einen ebensolchen Gebrauchswert besitzen wie Metalllampen. Ihre Vorteile liegen in erster Linie im geringeren Gewicht und Preis.
Taschenlampen aus Metalldrehteilen sind in der Regel höherwertig und mechanisch belastbarer als Kunststofflampen, allerdings auch dementsprechend teurer in der Anschaffung.
Die Batterien im Griff dienen der Lichtquelle als Stromquelle. Die meistverbreiteten Varianten, um die Lampen an- und auszuschalten, sind ein drehbarer Lampenkopf oder ein im Griff eingelassener Schalter.
Die Lichtquelle ist bei einigen Modellen am Griffteil der Lampe befestigt, während der umgebende Spiegel am drehbaren Kopf der Lampe angebracht ist. So ist durch Drehen des Kopfs oft eine variable Fokussierung des Leuchtmittels möglich. Z. B. kann der Strahl divergent eingestellt werden, um auf Kosten der Intensität eine größere Fläche zu beleuchten.
Einsatzmöglichkeiten
Die Einsatzmöglichkeiten für Taschenlampen sind äußerst vielfältig. Sie reichen vom Lichtspender während eines Sicherungswechsels bei Stromausfall über Nachtwanderungen, Campingtouren bis hin zu Tauchgängen in größerer Tiefe. Für die einzelnen Bereiche existieren dabei spezielle Lampentypen, beispielsweise solche mit größeren Batterien für längere Betriebsdauer oder wasserdichte Lampen zum Tauchen. Bei allen Arten von Rettungskräften, Sicherheitskräften, Feuerwehr und Polizei gehören Taschenlampen zur Grundausstattung.
Lampen zur Notbeleuchtung sind oft in Wandhalterungen untergebracht, die zugleich die Erhaltungsladung und das Nachladen für den Akku sicherstellen. Sie leuchten, sobald sie abgenommen werden.
Generell können mit Taschenlampen allerdings nur relativ kleine Flächen in kurzem Abstand beleuchtet werden. Um größere Bereiche auszuleuchten, werden Scheinwerfer benötigt.
Stromversorgung
- Meistens werden die Taschenlampen über Batterien mit Strom versorgt.
- Vor allem professionelle Taschenlampen besitzen einen integrierten Akku, welcher mit einem Ladegerät an der Steckdose aufgeladen werden kann.
- Dynamotaschenlampen ohne Akku waren zu Glühlampenzeiten die einzig zuverlässige Lichtquelle. Die Lampe leuchtete, solange man den Generator durch Zusammenpressen gegen Federdruck und Öffnen der Hand betätigte. Akkus und Batterien hatten früher eine hohe Selbstentladung, und sind auch bei Gebrauch irgendwann entladen, ein Generator ist unerschöpflich.
- Dynamotaschenlampen mit Akku gibt es heute mit LEDs in verschiedenen mehr oder weniger billigen Versionen, ein paar Minuten Kurbeln reicht für ein paar Minuten Leuchtdauer.
- Induktionsspule: Hier enthält die Taschenlampe eine Metallspule mit eingelassenem Magneten. Durch Schütteln wird dabei ein integrierter Akku oder Kondensator aufgeladen. Vorteil dieser Variante ist die Unabhängigkeit von einer Stromquelle. Nachteilig kann jedoch der höhere Aufwand zur Aufladung sein, somit wäre es sinnvoll, den Akku z. B. auch mit einem Netzteil aufladen zu können. Außerdem können durch die Bewegung die Leuchtmittel beschädigt werden, weil der Glühfaden reißen kann, daher sollten diese Taschenlampen LEDs enthalten.
- Noch nicht durchgesetzt hat sich die Aufladung mittels einer Solarzelle, wobei die Taschenlampe tagsüber in eine starke Lichtquelle, wie Sonnenlicht gelegt wird. Durch die Solarzelle wird dabei ein Akku aufgeladen. Auch hier ist eine zweite Energiequelle zu empfehlen.
Spezielle Taschenlampen
Neben den herkömmlichen Taschenlampen existieren noch Lampen, die außer einer normalen Glühlampe seitlich im Griff noch über eine kleine Leuchtstofflampe verfügen, mit deren Hilfe effektiver Licht erzeugt und folglich eine etwas größere Fläche beleuchtet werden kann. Der Stromverbrauch solcher Lampen ist relativ hoch, so dass die Batterien beim Einsatz der Leuchtstoffröhre schneller erschöpft sind. Es werden auch Kaltkathodenfluoreszenzröhren (CCFL) eingesetzt. Die Lichtausbeute dieser Leuchten ist höher als die von LEDs, die Licht-Bündelung jedoch geringer.
Ein weiteres oft anzutreffendes Extra ist ein orangefarbenes Blinklicht, das vor allem zur Warnung, beispielsweise bei Autounfällen, gedacht ist. Auch Kompasse werden teilweise eingebaut, deren korrekte Funktion ist allerdings in Anbetracht der Stromleitungen in der Lampe und der resultierenden Magnetfelder eher fraglich. Bei Outdoor-Aktivitäten, z. B. Bergsteigen, Camping oder Höhlen-Wanderungen finden heute auch Stirnlampen eine immer größere Verbreitung. Gegenüber herkömmlichen Taschenlampen haben sie den Vorteil, dass durch Tragen mit einem Gummiband am Kopf beide Hände freibleiben. Oft sind Stirnlampen nur oder zusätzlich mit LEDs ausgestattet, um so eine Brenndauer von bis zu 200 Stunden zu gestatten.
Bei als Abenteuerlampen bezeichneten Leuchten werden, um den größeren Strombedarf zu decken oder um die Betriebsdauer zu erhöhen, oft sehr große und relativ viele Batterien oder Akkus eingesetzt. Das erhöht einerseits das Gewicht der Lampe und macht sie größer und führt andererseits zu Veränderungen in der Konstruktion. Da der Griff durch viele und große Batterien zu dick wird, um die Lampe in einer Hand zu halten, wird dazu stattdessen ein zusätzlicher Kunststoff- oder Metallbügel an der Oberseite der Lampe befestigt.
Es gibt auch Taschenlampen, die ohne Batterien funktionieren. Diese enthalten als Strompuffer Akkus oder Doppelschicht-Kondensatoren, die über Solarzellen oder einen Generator geladen werden. Je nach Konstruktion wird der Generator durch Schütteln, Seilzug oder Kurbel angetrieben. Derartige Taschenlampen arbeiten meist mit LEDs, da diese weniger Strom als herkömmliche Glühlampen benötigen (Gasentladungslampen können aber teilweise einen ähnlich hohen Wirkungsgrad erreichen).
Taschenlampen werden auch explosionsgeschützt hergestellt, sie können dann in der Nähe von leicht entzündlichen Stoffen oder innerhalb brennbarer Gasgemische verwendet werden. Ein Beispiel dafür sind Grubenlampen.
LED-Taschenlampen
Die Technik der Taschenlampe wird aktuell durch die Entwicklung preiswerter weißer Leuchtdioden grundlegend verändert. Wesentliche Vorteile sind die lange Lebensdauer des Leuchtmittels, die Unempfindlichkeit gegenüber Stößen, der geringere Stromverbrauch, die Unabhängigkeit der Lichtfarbe von der Batteriespannung und oftmals eine über einen weiten Bereich regulierbare Helligkeit. Leuchtdioden erreichen mittlerweile etwa den fünffachen Wirkungsgrad von Glühlampen. Während Glühlampen ohne mechanische Belastung durchschnittlich einige 100 bis einige 1000 Stunden bis zum Totalausfall halten, in Taschenlampen oft deutlich kürzer, wird bei weißen LEDs inzwischen bei sachgerechter Verbauung eine Lebensdauer von mehr als 100.000 Stunden (11½ Jahre) angenommen. Als Lebensdauer wird dabei die Zeit bis zum Absinken auf die halbe Anfangshelligkeit bezeichnet, da ein kompletter Ausfall aufgrund von Alterung meist sehr viel länger dauert. Da LEDs zudem im Vergleich zu Glühlampen sehr stoßunempfindlich sind, müssen sie im Gegensatz zu Glühlampen während der Lebensdauer einer Taschenlampe nicht erneuert werden. Grund für eine vorzeitige Alterung oder einen Komplettausfall von LEDs ist in der Regel eine ungeeignete Stromversorgung, zu hohe Last und unzureichende Kühlung. Die Lebensdauer der LEDs sinkt bei Überlastung sehr stark, die nutzbare Helligkeit kann bei starker Überlastung schon nach deutlich unter 1000 Stunden statt der beworbenen 100.000 auf die Hälfte der Anfangshelligkeit sinken, zum Teil sogar nach weniger als 100 Stunden.[3] Günstige LEDs, wie sie in billigen Taschenlampen verbaut werden, sind hier oft weniger widerstandsfähig als LEDs von Markenherstellern[4]. Da eine Taschenlampe jedoch gewöhnlich nur selten gebraucht wird, spielen diese Aspekte bei der Konzeption günstiger Taschenlampen keine Rolle. Nicht regelmäßig benutzte Taschenlampen (z.B. Notfalllampe im Haushalt) werden wahrscheinlich niemals 1000 Stunden Betriebsdauer erreichen, so dass es den Herstellern egal sein kann, ob die LEDs überlastet werden.

Kostengünstige LED-Taschenlampen sind meist mit kunststoffummantelten Leuchtdioden aufgebaut, wie sie auch in Anzeigen und als Signallämpchen zur Anwendung kommen. Die Kunststoffhülle dient dabei gleichzeitig als Linse zur Fokussierung des abgestrahlten Lichtes, so dass im Gegensatz zu Modellen mit Glühlampe oder Hochleistungs-LED kein separates optisches System zur Bündelung des Lichts verbaut werden muss. Die Lichtleistung bei Leuchtdioden von diesem Bautyp ist jedoch begrenzt, da sich keine effiziente Kühlung realisieren lässt, wie sie bei höherer Leistungsaufnahme notwendig wird. Die Hersteller kompensieren dies, indem sie viele Leuchtdioden in einem gemeinsamen Gehäuse verbauen, was jedoch aufgrund der Bauform nur begrenzt möglich ist und, verglichen mit einer Lampe mit einem einzelnen Hochleistungsleuchtmittel und einer Optik vergleichbarer Größe, in einer diffuseren Lichtabgabe resultiert. Diese Taschenlampen sind vor allem für den Einsatz in Haushalt und Hobby geeignet, wo keine konzentrierte Lichtabgabe nötig ist und ein günstiger Anschaffungspreis im Vordergrund steht. Die Entwicklung derartiger LED-Taschenlampen hat inzwischen die Grenze von 200 Einzel-LEDs erreicht. Da der Lampenkopf dann einen Durchmesser von 11cm hat, erinnert die Lampenform an einen Duschkopf.
Hochwertige LED-Taschenlampen
Inzwischen bieten viele Hersteller hochwertige LED-Taschenlampen an, die sich durch robuste Verarbeitung und eine hohe Lichtleistung auszeichnen. Die Abbildung auf der rechten Seite zeigt zwei Extreme, an denen deutlich wird, welche Möglichkeiten sich durch den Einsatz von Leuchtdioden ergeben: Links eine LED-Taschenlampe mit 2200 Lumen, rechts ein sehr kleines Modell mit 180 Lumen Lichtleistung.
Leuchtmittel: Im Gegensatz zu günstigeren LED-Taschenlampen werden bei hochwertigen Modellen in der Regel einzelne Leuchtdioden verbaut, die jedoch aufgrund ihrer Bauform eine passive Kühlung erlauben und dadurch wesentlich leistungsstärker sein können. Meist werden weiße Leuchtdioden mit Bauteil-Nennleistungen von 1, 3 oder 5 Watt eingesetzt. Bei einigen Modellen kommen aber auch deutlich leistungsstärkere Leuchtdioden mit Nennleistungen bis zu 30 Watt zum Einsatz.[5] Die effizientesten verfügbaren weißen LEDs erreichen derzeit eine Lichtausbeute von über 150 lm/W, noch effizientere LEDs mit über 200 Lumen/Watt sind angekündigt (Stand 07/2011)[6]. Taschenlampen, die mit Cree LEDs ausgestattet sind, haben eine Leuchtdauer von bis zu 100.000 Stunden (bei noch mindestens 70 % Leuchtkraft). Der Stromverbrauch liegt bei gleicher Leuchtkraft 20-50 % unter den bisheriger LEDs.[7] Der Artikel Lichtquellen enthält eine Tabelle mit Beispielen für die Lichtausbeute.
Linse: Die Transmission der Lichtleistung kann durch den Einsatz von Glaslinsen (UCL-Linsen) im Gegensatz zu Plastiklinsen höher und langzeitstabiler sein. Eine verkratze Plastiklinse z. B. streut den Lichtstrahl unnötig in alle Richtungen und senkt damit die Helligkeit des nutzbaren Lichtkegels. Ein Nachteil ist die höhere Bruchgefahr – andererseits sind Glaslinsen austauschbar, während Plastiklinsen oftmals fest mit dem restlichen Gehäuse verbunden sind.
Gehäuse: Taschenlampengehäuse können für höhere Anforderungen ausgelegt und beispielsweise gegen eindringende Nässe geschützt sein, teilweise auch IPX8 (z. B. 30 Minuten in 2 m Wassertiefe) oder im Fall von Tauchlampen noch mehr. Lampengehäuse aus anodisiertem Aluminium sind kratzresistenter und helfen bei der Wärmeabfuhr, wie sie bei LED-Lampen oberhalb von etwa 1 Watt wichtig ist. Plastikgehäuse leiten Wärme nur schlecht nach außen ab und werden bei Hochleistungs-Taschenlampen daher nur selten verwendet.
Elektronik: Ein entsprechend dimensionierter Treiberbaustein in Form einer Konstantstromquelle ermöglicht eine gleichbleibende Helligkeit der Taschenlampe über annähernd die gesamte Batterielaufzeit. In den Treiber integrierte Spannungskonverter ermöglichen außerdem das Betreiben einer LED-Taschenlampe aus der geringen Spannung einer einzelnen Mignon- oder Microbatterie (Step-Up), oder aber die variable Nutzung mehrerer beliebiger Zellen (Step-Down), um die Laufzeit zu verlängern. Temperatursensoren in Lampen reduzieren automatisch die Leistung, um einem Defekt durch Überhitzung vorzubeugen. Nicht stromgeregelte Taschenlampen nutzen zur Strombegrenzung lediglich den Innenwiderstand der Batterie. Die Leuchtdioden laufen dann mit neuen Batterien permanent oberhalb ihrer Spezifikation, was sie aufgrund von Überhitzung vorzeitig altern lässt. Neben dieser steten Abnahme der Maximalhelligkeit ist zudem die Helligkeit vom Ladestand der Batterie oder des Akkus abhängig. Weitere Nachteile sind mögliche Farbveränderungen, etwa ein Grünstich, wenn die LED oberhalb ihrer vorgegebenen Maximalleistung betrieben wird, sowie ein fehlender Tiefentladungsschutz von Akkuzellen. In der Regel dürfen solche Taschenlampen ohnehin nicht mit Akkus betrieben werden, da diese gegenüber Alkali-Mangan-Batterien einen geringeren Innenwiderstand aufweisen.
Bedienkonzept: in Europa erhältlichen Taschenlampen haben den Einschaltknopf häufig am vorderen Ende des Schafts - die Bedienung gleicht der einer HiFi-Fernbedienung, in den USA ist der Schalter häufig am Lampenende angebracht ("American Style") und wird wie ein Kugelschreiber bedient.
Schaltstufen/Funktionen: Immer mehr Taschenlampen lassen sich nicht nur ein- und ausschalten, sondern besitzen weitere Funktionen, z. B. das Einstellen der Lichtstärke in mehreren Stufen. Außerdem findet man oft eine SOS- und verschiedene Blitz-Funktionen (engl. Strobe). Bei einem Locator-Flash blitzt die Lampe alle paar Sekunden schwach auf, so dass man sie auch im Dunkeln findet. Ebenso verfügen einige Modelle über wechselbare Farben. Die verschiedenen Modi werden oftmals durch das gezielte Betätigen des Einschaltknopfes gewechselt, der dazu halb oder vollständig durchgedrückt wird (Clicky). Manche Taschenlampen besitzen einen USB-Anschluss, über den man nutzerdefinierte Funktionen einprogrammieren kann.
Die Blendwirkung starker Lampen kann das Sehvermögen signifikant einschränken, so dass eine Orientierung z. B. im Straßenverkehr erschwert oder unmöglich wird. Dies liegt daran, dass mit der Taschenlampe angeleuchte Gegenstände das Licht zurück in die Augen reflektieren und die Pupillen sich somit verengen, siehe Adaptation. Besonders stark ist der Effekt bei zuvor an die Dunkelheit angepassten Augen. Hinzu kommt bei unerwarteter Blendung ein zum Teil starker Überraschungseffekt.[8]
Sonstiges
In den USA wird jeweils am 21. Dezember der „Tag der Taschenlampe“ („Flashlight Day“) begangen.[9]
Weblinks
Einzelnachweise
- http://www.google.com/patents/about?id=8mArAAAAEBAJ&dq=David+Misell
- Stiftung Warentest: Taschen- und Stirnleuchten - Nur 5 sind gut in: test 01/2006 (online abgerufen am 4. Februar 2013)
- http://www.molalla.net/members/leeper/5mmdeg.htm Messungen der Lichtabgabe versch. LEDs über die Betriebsdauer bei versch. Belastungen, Englisch
- Test von verschiedenen LED Taschenlampen Abgerufen am 30. Dezember 2014.
- 30-Watt LED von Luminus
- Pressemitteilung Cree Inc.: Cree erreicht im Labor 231 Lumen pro Watt 9. Mai 2011
- Cree LED Taschenlampe Abgerufen am 21. Januar 2013.
- Sicherer Umgang mit Hochleistungs-LED - Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (Memento vom 5. Dezember 2011 im Internet Archive)
- Timo Lokoschat: Es wird eng im Kalender. 365 kuriose Gedenk- und Feiertage. Sanssouci Verlag. S. 201 ISBN 978-3-8363-0218-0
Surefire
| SureFire LLC | |
|---|---|
 |
|
| Rechtsform | LLC |
| Gründung | 1979 |
| Sitz | Fountain Valley (Kalifornien), Vereinigte Staaten |
| Website | www.SureFire.com |
SureFire LLC ist ein kalifornischer Hersteller von Taschenlampen. Hauptkunden sind, nicht zuletzt wegen des vergleichsweise hohen Preises der Lampen, die Polizei und das Militär.
Inhaltsverzeichnis
Produktmerkmale
Da die Surefire-Lampen weniger für den massenhaften Privatgebrauch, sondern vorrangig für den professionellen Einsatz bei Polizei, Militär und Spezialeinheiten gebaut werden, unterscheiden sie sich in ihrer Qualität und Leistungsfähigkeit erheblich von herkömmlichen Taschenlampen. Dies schlägt sich natürlich auch im Preis nieder, der bei der billigsten Surefire-Lampe ungefähr auf dem Preisniveau der teuersten Maglite liegt (mit Ausnahme der wiederaufladbaren Modelle). Da die meisten Surefire-Modelle mit den relativ teuren CR-123A-Lithium-Batterien – die gemäß der Firmenphilosophie viel Leistung in einem geringen Volumen ermöglichen – betrieben werden, liegen auch die laufenden Kosten ganz erheblich über denen vergleichbarer Modelle mit Standard-Batterien. Diese Betriebskosten lassen sich durch den Einsatz wiederaufladbarer SureFire Lampen deutlich reduzieren.
Neben den bislang existierenden Waffenlampen, die über Adapter an der Waffe oder den dafür vorgesehenen RIS-Schienen montiert werden, gibt es jetzt auch Modelle in Form eines Frontgriffes. Leuchteinheiten die zum Gebrauch an einer Waffe bestimmt sind, stellen verbotene Gegenstände im Sinne des deutschen Waffengesetzes dar.
Gehäuse
Eine typische Surefire-Lampe besteht aus CNC-gefrästem Aluminium mit eloxierter Oberfläche, die Linse wird aus hochtemperaturbeständigem Pyrex-Glas hergestellt. Außerdem gibt es auch Modellreihen, die aus Nitrolon hergestellt werden. Diese sind bei extrem niedrigen Temperaturen angenehmer anzufassen.
Leuchtmittel

Leuchtmittel und Reflektor bilden eine aufeinander abgestimmte, vorfokussierte Einheit, die beim Ausfall komplett ersetzt wird. Die dadurch möglichen engeren Fertigungstoleranzen tragen in erheblichem Ausmaß zu der hohen Lichtausbeute der Lampen bei. Es kommen sowohl spezielle Glühbirnen (mit einer Gasmischung), LEDs und Xenon-Leuchtmittel (Gasentladungstechnik) zum Einsatz. Einzelne Modelle verfügen über eine umschaltbare Kombination aus LEDs („Orientierungslicht“) und Xenon („Einsatz- beziehungsweise Kampflicht“). Darüber hinaus sind Modelle verfügbar, die an Schusswaffen montiert werden können. Voraussetzung dafür ist neben der speziell angepassten Gehäuseform vor allem eine stoßgeschützte Leuchtmitteleinheit, die die erheblichen Erschütterungen beim Abfeuern eines Schusses verkraftet.